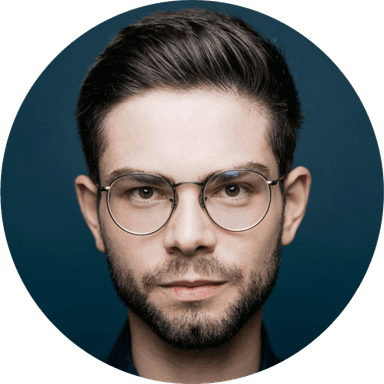Auch wenn Wählerinnen und Wähler am 23. Februar ihr Kreuz mit einem Stift auf Papier machen, läuft die Bundestagswahl digital ab. Zuerst werden die Wahlzettel im Stimmbezirk ausgezählt und in einer physischen Niederschrift zusammengefasst. Aber für das vorläufige Wahlergebnis gibt jedes Wahlamt die ausgezählten Stimmen als sogenannte Schnellmeldung in ein IT-System ein. Das wiederum übermittelt die Ergebnisse an das Bundesland und führt sie dann zum Bundesergebnis zusammen.
Doch wo IT im Spiel ist, kann sie gehackt werden. Wie soll die Sicherheit gewährleistet werden?
Hilfreich wäre es, wenn die eingesetzte Software die höchstmöglichen Cybersicherheitskriterien erfüllte. Doch das ist fraglich. Die Bundeswahlleitung setzt Software der Votegroup ein, um das vorläufige Wahlergebnis zu erfassen. Dieses Unternehmen, kritisierten Hacker zuletzt auf dem Chaos Communication Congress (CCC), hat seine Konkurrenten in den vergangenen Jahren aufgekauft und hat damit in Deutschland eine Monopolstellung. IT-Experten deckten zudem einige Angriffsvektoren bei Software der Votegroup auf. Unter anderem fehlten sicherheitsrelevante Signaturen. Sie sagten: „Die Software, die aktuell im Einsatz ist, entspricht den Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nicht.“
Die Bundeswahlleitung selbst sagt zum Rahmenvertrag: „Die Votegroup GmbH hat den Zuschlag für die Ausschreibung erhalten, es gab keine weiteren Mitbewerber.“ Die Software der Votegroup, die sie nutze, sei zudem nicht dieselbe, die beim CCC kritisiert wurde. Die Votegroup selbst äußert sich nicht zur Kritik des CCC. Cybersicherheitsexpertinnen und -experten können nicht genau nachprüfen, wie sicher die Wahlsoftware ist, da der entsprechende Quellcode nicht offiziell zugänglich ist. Eine solche Transparenz wäre für sie hilfreich und wird von ihnen auch gefordert.
Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums (BMI) sagte dazu: Als besonders schützenswert eingestufte Informationen gebe man grundsätzlich nicht heraus. In anderen europäischen Ländern ist man dort allerdings offener. Aber auch aus dem BMI hieß es, die Bundeswahlleiterin werde künftig faktenbasiert prüfen, „wie angesichts der hohen, auch sicherheitskritischen Relevanz mit dem Quellcode der auf Bundesebene eingesetzten Software für bundesweite Wahlen umzugehen ist“.
Aber warum ist überhaupt die Bundeswahlleitung für die IT-Sicherheit zuständig, wenn es eine Behörde gibt in Deutschland, die sich damit speziell auskennt?
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hätte die fachlichen Kompetenzen, zu beurteilen, ob die Software sicher genug ist, um für die Bundestagswahl eingesetzt zu werden. Aber die Bundeswahlleitung sagt: „Es besteht derzeit keine gesetzliche Regelung und damit keine rechtliche Vorgabe zur Zertifizierung von Wahlsoftware.“ Das BSI kann also, selbst wenn es wollte, keine Vorgaben zur IT-Sicherheit machen.
Die Bundeswahlleiterin teilt zwar mit, das System für die Bundestagswahl mit dem BSI-Webcheck überprüft zu haben und regelmäßig mit dem BSI im Austausch zu stehen. Aber eine gesetzliche Grundlage, die dem BSI erlaubt, hier durchzugreifen, gibt es nicht. Die Frage, ob die Bundestagswahl mit der derzeitigen Software sicher ist, beantwortet das BSI nicht und verweist auf die Bundeswahlleitung.
Eine BMI-Sprecherin antwortete auf die Frage, warum das BSI keine rechtliche Grundlage habe, um die Wahlsoftware zu zertifizieren: „Die Bundeswahlordnung (BWO) sieht bisher weder eine Zuständigkeit des Bundes noch sicherheitstechnische Anforderungen an die Wahlsoftware vor. Ob eine solche Rechtsgrundlage geschaffen werden kann, wird in der kommenden Legislaturperiode zu prüfen sein.“ In dieser Legislaturperiode sei keine Entscheidung dazu möglich gewesen – aufgrund des vorgezogenen Wahltermins, wie es nun praktischerweise heißt.
Die Frage, wie sicher die Software der Bundestagswahl ist, lässt sich also von außen kaum nachvollziehen. Die Cybersicherheitsbehörde selbst beantwortet die Frage nicht und hat keine rechtlichen Interventionsmöglichkeiten. Das Unternehmen äußert sich nicht. IT-Sicherheitsexpertinnen und -experten haben keinen offiziellen Quellcode, der die für sie notwendige Transparenz herstellen würde.
Beim amtlichen Wahlergebnis sieht es anders aus. Denn die Niederschriften der Wahlergebnisse werden physisch beim jeweiligen Land gesammelt und am Ende zur Bundeswahlleiterin gebracht. Eine Auszählung ohne ein digital hackbares System ist also immerhin für das amtliche Wahlergebnis möglich. Selina Bettendorf