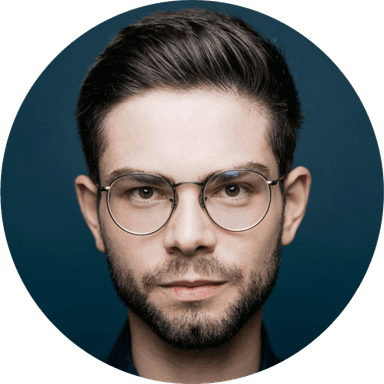Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerbenGuten Morgen. Es soll also doch ein Quadrell werden. RTL und ntv laden zum geplanten TV-Duell mit Olaf Scholz und Friedrich Merz am 16. Februar nun auch Robert Habeck und Alice Weidel ein. Merz' erneuter Vorstoß hat gewirkt, der zähe Protest der Grünen ebenfalls. Der Unions-Kanzlerkandidat hatte sich ein Format mit Weidel gewünscht, was nun zumindest im Privatfernsehen klappt, falls alle zusagen. Zuvor hatten ARD und ZDF dem Tagesspiegel mitgeteilt, dass es bei dem ursprünglichen Plan bleibt.
Merz will Gelegenheit, die Dinge so gerade zu ziehen, wie er sie sieht: „Dann wird noch mal klar, dass AfD und Union nichts verbindet“, hatte er gesagt. Zuschauer hätten auch etwas davon, es würden schließlich „Fetzen fliegen“. Weidel hielt das auch für eine gute Idee, zum Zwecke, den CDU-Chef programmatischer Plagiate überführen zu können. Die Grünen lobten den Vorschlag, als würde unter allen Vieren das Kanzleramt ausgeschnapst.
Das ZDF wunderte sich, schließlich habe man Merz vergangene Woche zu einem Streitgespräch mit Weidel bei Illner oder Lanz eingeladen, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. Merz habe aus terminlichen Gründen abgesagt. Aber im Wahlkampf ändern ein paar Tage eben alles. RTL-Politikchef Nikolaus Blome schrieb auf X, als er das Vierer-Format gestern ankündigte: „Was muss, das muss.“
Willkommen am Platz der Republik.
ANZEIGE
Was wichtig wird
Es bleibt dabei. „Wir werden unsere Anträge auf die Tagesordnung bringen, ja“, sagte Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz gestern vor Reporterinnen und Reportern. Es sei ihm nach wie vor egal, sollte bei seinen Migrationsplänen auch die AfD zustimmen. Merz ging sogar weiter: Die Verantwortung dafür, dass es keine Mehrheit aufgrund der AfD gibt, liege nun bei SPD und Grünen. Derweil haben FDP und SPD eigene Anträge und Papiere präsentiert.
Beschluss in dieser Woche: Was mit den Formulierungen der Unions-Fraktion für ein neues Gesetz startete, über die wir gestern berichteten, endet wohl mit dem bereits existierenden Zustrombegrenzungsgesetz. Fraktionsvize Andrea Lindholz teilte auf X mit, die Union werde das Vorhaben zur Abstimmung bringen. Möglicherweise auch, um der AfD zuvorzukommen. Da es bereits in erster Lesung und im Innenausschuss war, kann es diese Woche bindend beschlossen werden, falls die Fraktion das heute so bestätigt. Auch die anderen Anträge sollen eingebracht werden.
Zustimmung aus dem Genscher-Haus: Die FDP hat zwar ein eigenes Papier präsentiert, das SZ Dossier vorliegt, will aber auch beim Merz-Plan mitgehen. „Die von Angela Merkel begründete und von Bündnis 90/Die Grünen sowie relevanten Teilen der SPD unbeirrt fortgesetzte Politik der unkontrollierten Migration hat das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Staates tief erschüttert“, schreiben die Liberalen – ganz so, als hätten sie in der Ampel nicht mitregiert.
Im FDP-Papier: Drittstaatsverfahren, nationale Ausreisezentren an Flughäfen, keine Sozialleistungen mehr für Schutzsuchende, die ausreisen müssen; kein Familiennachzug mehr für subsidiär Schutzberechtigte; Entwicklungszusammenarbeit soll eingestellt werden, wenn Länder sich weigern, ihre Staatsbürger zurückzunehmen; eine „Erneuerung der EU-Türkei-Erklärung“. Die Zurückweisung von Asylbewerbern soll „erprobt“ werden. Die Zeichen stehen mehr auf Schwarz-Gelb denn je. Wären da nicht die Umfragewerte, vor allem jene der Liberalen, die eine solche Koalition derzeit ausschließen.
Politische Signale: Für diesen politischen Wunschtraum reihte sich FDP-Chef Christian Lindner jedenfalls hinter Merz ein: „Das ist mir sogar egal, ob die AfD dort mitstimmt“, sagte er im Deutschlandfunk. Es gehe um ein „politisches Signal“ des Bundestages. Auch das BSW will zustimmen, mit der AfD gibt es zumindest rechnerisch eine Mehrheit (hier gibt es die Vorgeschichte). Generalsekretär Marco Buschmann sagte: „Wenn Demokraten nicht mehr sagen, was sie für richtig halten, dann hat die AfD schon gewonnen.“ Die AfD-Fraktionsspitze will ihren Abgeordneten laut übereinstimmenden Medienberichten heute übrigens eine Zustimmung aller CDU-Anträge empfehlen.
Die SPD hat ausgeschlossen, den Merz-Plänen zuzustimmen. Dafür hat der Parteivorstand ebenfalls ein Papier beschlossen, das SZ Dossier vorliegt. „Konsequent für die Sicherheit in Deutschland“ steht darüber. Zunächst wird einiges aufgezählt, was der SPD als eigener Erfolg gilt, etwa die temporären Grenzkontrollen. Das Grundrecht auf Asyl, heißt es, stehe „nicht zur Disposition“.
Wer blockiert hier wen? „Seit Wochen liegen weitere umfangreiche Gesetzesentwürfe für mehr Sicherheit und Steuerung der Migration auf dem Tisch und werden von der Union blockiert oder als nicht dringlich erachtet“, schreiben die Sozialdemokraten. Die SPD wolle diese Maßnahmen noch vor der Wahl beschließen – und biete allen „demokratischen“ Fraktionen einen Weg an. Genannt werden etwa die Maßnahmen für mehr Kompetenzen der Sicherheitsbehörden aus dem Sicherheitspaket der Ampel, die Novelle des Bundespolizeigesetzes oder eine schnelle Umsetzung der europäischen Asylreform, also hier und da eine graduelle Verschärfung des Status quo.
Verunsicherte Bevölkerung: Die SPD will auch, dass die „Gefährlichkeit von Menschen, die aufgrund psychischer Erkrankungen eine Gefahr für sich wie für andere darstellen“, von den Behörden besser „erkannt und erfasst“ werden kann. „Die verständliche Wut über unvorstellbare Gewalttaten darf nicht zu Enthemmung und Radikalisierung führen“, schreiben die Sozialdemokraten. Merz' Äußerungen im Hinblick auf die AfD „verunsichern“ Bürgerinnen und Bürger, meint die SPD zu beobachten und warnt vor einem „in Kauf genommenen Tabubruch“.
Die Sätze „Nie wieder“ und „Nie wieder ist jetzt“ waren in den vergangenen Tagen häufiger zu lesen: Rund um den 27. Januar, den Gedenktag an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz, wird der Appell, die Gräuel der Nazis nicht noch einmal geschehen zu lassen, wieder lauter. Dieses Datum hat das Netzwerk „Neue Deutsche Organisationen“ (NDO) zum Anlass genommen, um seine Kampagne vorzustellen. Elena Müller war vor Ort und berichtet.
Wahlwerbung für links: Ab sofort soll der Slogan „Nie wieder ist am 23. Februar“ auf Social Media und Plakaten zu lesen sein. Die Aktion, unterstützt von der Werbeagentur Scholz & Friends, soll Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, bei der Bundestagswahl für jene Parteien zu stimmen, die „die Brandmauer zur AfD respektieren“ und Belange von „Migrantinnen und Migranten und anderen marginalisierten Gruppen in den Blick nehmen“. So erläuterte es Vorständin Sheila Mysorekar bei der Vorstellung der Kampagne gestern in Berlin.
Auf Kosten der „Anderen“: Die NDO bezeichnen sich selbst als „postmigrantisches Netzwerk“, in dem sich 200 Organisationen und Initiativen aus ganz Deutschland zusammengetan haben. „Wir sind ein breites Bündnis von Minderheiten“, sagte Co-Vorstand Karim El-Helaifi. Er schalt Parteien, ihre Vorschläge zur Migrationspolitik seien von „Narrativen“, nicht Problemen getrieben: „Dadurch, dass rechte Narrative auch von anderen Parteien übernommen werden, wird versucht, auf dem Rücken von Minderheiten und marginalisierten Gruppen Stimmen zu gewinnen.“
Deutscher Pass mit der Geburtsurkunde: Das Netzwerk formulierte Forderungen an die künftige Bundesregierung – wie eine erneute Reform des Staatsangehörigkeitsrechts mit dem Ziel eines leichteren Zugangs zum deutschen Pass. Die NDO fordern hier eine Erweiterung des Geburtsortsprinzips, das in den USA von der Verfassung garantiert wird, das der neue Präsident aber abzuschaffen plant: Alle Kinder, die in Deutschland geboren werden, sollten die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen, so die Forderung des Bündnisses.
Die EU-Außenminister haben die Russland-Sanktionen um weitere sechs Monate verlängert. Möglich wurde das, weil Ungarn seinen Widerstand nach tagelangem Gerangel aufgegeben hat. „Europa liefert“, schrieb die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in den sozialen Netzwerken. „Russland muss für die von ihm verursachten Schäden bezahlen.“ Das berichtet unser Dossier Geoökonomie.
Der Druck auf Putin steigt: Russlands Wirtschaft ist seit 2022 zwar nominal gewachsen, aber die Beschaffung westlicher Hightech-Komponenten – etwa für Waffen wie Raketenwerfer – ist kaum noch möglich. Waffenproduktion treibt zwar das BIP, schafft aber keine nachhaltigen Werte. Wenn Russland weiterhin isoliert bleibt, könnte sein Wachstum schon 2025 einbrechen – auch aufgrund der noch von Joe Biden deutlich verschärften US-Ölsanktionen und überhitzten Binnenmärkte. Leitzinserhöhungen auf 21 Prozent würgen das Wachstum bereits ab.
Trump zieht die Schrauben zusätzlich an: Der US-Präsident hat angedeutet, dass er die US-Sanktionen weiter verschärfen könnte, falls Putin nicht zu Friedensverhandlungen bereit ist. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán pflegt demonstrativ Nähe zu Trump und hat dessen Haltung zu Russland abgewartet, bevor er grünes Licht für die EU-Entscheidung gegeben hat. Diese musste einstimmig erfolgen.
ANZEIGE
Tiefgang
Wahlkampf hat bekanntlich nicht nur mit Fakten und Forderungen zu tun, sondern auch mit Psychologie. Im Rennen um die Fünf-Prozent-Hürde ist die besonders bei den Umfragen wichtig: Wenn diese das Signal geben, dass eine Partei dort die kritische Marke für den Einzug ins Parlament erreicht, kann das unentschlossene oder taktische Wählerinnen und Wähler durchaus beeinflussen.
„Dass die fünf Prozent in den Umfragen eine psychologische Wirkung auf strategisch wählende Menschen haben könnte, kann ich mir gut vorstellen“, sagte dazu die Marburger Professorin für politikwissenschaftliche Methoden und Demokratie im digitalen Wandel, Isabelle Borucki. Denn dann sei deren Stimme nicht „verschwendet“.
Das denken sie sich wohl auch bei der FDP. In einem Berliner Wahlbezirk rief die Bezirksvorsitzende deshalb ihre Parteifreundinnen und -freunde dazu auf, auf der Umfrageplattform Civey bei der Umfrage „Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?“ für die FDP zu stimmen: „Bei der Umfrageplattform Civey können wir aktiv dazu beitragen, die Ergebnisse zugunsten der FDP zu beeinflussen, indem wir unsere Stimme abgeben“, schrieb die Bezirksvorständin in einer E-Mail, die SZ Dossier vorliegt.
Die Orts-, Kreis- und Landesverbände anderer Parteien nutzten diese Methode auch, um Stimmen hinzuzugewinnen, hieß es in der Mail weiter. „Auch für die FDP ergibt sich daraus die Notwendigkeit, nachzuziehen, da solche Umfragen mit Blick auf die Fünf-Prozent-Hürde auch psychologisch eine große Auswirkung auf den Wahlausgang haben können.“
Aber bringt das massenhafte Abstimmen in eigener Sache tatsächlich was? Plattformbetreiber Civey sagt: Nein. Man biete zwar allen Nutzerinnen und Nutzern an, sich an Umfragen zu beteiligen, doch zähle dabei „längst nicht jeder Klick“. Nicht die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, ob ihre Stimme berücksichtigt wird, teilte ein Civey-Sprecher mit.
„Stattdessen zieht ein Algorithmus automatisiert aus den Antworten unserer über einer Million deutschlandweit verifizierten Panelisten eine quotierte Stichprobe“. Diese würden dann nach offiziellen Zahlen, zum Beispiel vom Statistischen Bundesamt, gewichtet.
Es gibt noch weiteren Schutz vor Missbrauch: Im Hintergrund liefen „laufend technische, statistische und inhaltliche Plausibilitätschecks“. Civey prüft nach eigenen Angaben das Klickverhalten der Teilnehmenden und die Geschwindigkeit der Teilnahme sowie Widersprüche in gegebenen Antworten.
Ein plötzlich geballtes Abstimmungsverhalten würde der Technologie auffallen: Es wird dann nicht gewertet. „Unterm Strich: Bei Aufrufen zum gezielten Abstimmen handelt es sich um wirkungslose Versuche, die durch die üblichen Sicherheitsvorkehrungen erkannt und eliminiert werden“, so der Civey-Sprecher.
Das klingt auch für die Wahlforscherin Borucki plausibel: „Ich vermute, dass die algorithmische Überprüfung nochmal von Menschen überwacht wird. Normalerweise sind in solchen Prozessen mehrere Kontrollschleifen eingebaut.“ Die Umfragen ließen sich so laut der Expertin nicht „künstlich beeinflussen“, auch wenn die Parteien das gerne so hätten.
Zu den Umfrageergebnissen für die FDP teilt die Plattform zudem mit: „Grundsätzlich misst Civey für die FDP seit November fast unveränderte Werte – Tendenz aktuell eher leicht nach unten.“ Das ist bei Civey nicht anders als bei allen anderen Umfrageinstituten wie Forsa, Forschungsgruppe Wahlen oder YouGov: Auch dort liegen die Liberalen bei vier Prozent (Insa: 4,5 Prozent). Elena Müller
Fast übersehen
Neues zur Schuldenbremse: Wenn es um die Zukunft der Schuldenbremse geht, hat sich die Position der Deutschen scheinbar gewandelt. Wie eine neue Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) zeigt, ist erstmals eine Mehrheit der befragten Wahlberechtigten (55 Prozent) für eine Reform oder Abschaffung des Instruments, das 2009 im Grundgesetz verankert wurde. Dabei stellen die Zahlen eine deutliche Verschiebung im Vergleich zu November (44 Prozent) und Juli (32 Prozent) dar.
Spannend ist: Die Frage nach der Schuldenbremse scheint nicht mehr ausschließlich an der politischen Ausrichtung zu hängen. 55 Prozent der CDU- und 41 Prozent der FDP-Wählenden sprechen sich für eine Änderung des Instruments aus. Die Befragten wünschen sich mehr Investitionen in den Bereichen Bildung (87 Prozent), Verkehr (67 Prozent), Gesundheit (65 Prozent), innere Sicherheit (63 Prozent), Verteidigung (57 Prozent) und Energieinfrastruktur (53 Prozent). Für Kürzungen fand sich in den abgefragten Bereichen keine Mehrheit, auch im Sozialen wollen nur 19 Prozent der Befragten weniger Investitionen.
Rechte Attacke mit Glasflasche: Die Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut ist am Samstagabend in einem ICE von Heidelberg nach Stuttgart nach eigenen Angaben rassistisch und sexistisch beleidigt und körperlich angegriffen worden. Das hatte sie am späten Sonntagabend auf ihrem Instagram-Account öffentlich gemacht.
Sexuelle Belästigung im Zug: Dort berichtet sie, dass sie tätlich angegriffen worden sei, nachdem sie eine Gruppe Männer gefilmt hatte, die ihrer Aussage nach „AfD-Parolen riefen, sangen und grölten“. Zuvor sei sie auf dem Weg durch den Zug in den überfüllten Wagen „wiederholt sexuell belästigt und rassistisch beleidigt“ worden. Sie postete ein Foto einer kleinen blutenden Wunde an ihrem Kopf und das eines Mannes mit erhobenem Mittelfinger.
Überparteiliche Solidaritätsbekundungen erreichten Akbulut nach ihrem Post. Die Co-Parteichefin der Linken, Iris Schwerdtner, sagte am Montag, der Angriff sei Ausdruck einer rassistischen Verrohung im Land und versprach ihrer Parteikollegin Unterstützung.
Personalie: Die Senioren-Union der CDU hat Helge Benda kommissarisch zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Der 79-Jährige, bislang stellvertretender Bundesvorsitzender, tritt die Nachfolge von Fred-Holger Ludwig an, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt hat. Benda wird die Senioren-Union bis zur Neuwahl des Bundesvorstands im August 2025 in Magdeburg führen. Er gehört qua Amt auch dem CDU-Bundesvorstand an.
Forderungen: Die Senioren-Union sieht die neue Bundesregierung unter anderem in der Pflicht, sich den Herausforderungen der Pflege zu widmen. Dabei geht es ihr vor allem um die Unterstützung pflegender Angehöriger: „Pflegende Angehörige stehen oft ohne das nötige Equipment und Wissen da. Hier braucht es konkrete Maßnahmen der Politik“, sagte Benda. Ebenso betonte der Verband die Notwendigkeit steuerlicher Erleichterungen und verpflichtender Schulungen für pflegende Angehörige.
Unter eins
Bundeskanzler Olaf Scholz über die Erinnerung der jüngeren Generation an den Holocaust
Zu guter Letzt
Bis zum Equal Pay Day am 7. März sind es zwar noch ein paar Tage, aber in Sachen geschlechtergerechter Bezahlung ist die Welt (zumindest im Sport) seit gestern schon einen Schritt weiter: Zum ersten Mal in der Geschichte des Profifußballs wurde für eine Spielerin eine Ablösesumme von einer Million Euro gezahlt.
„Die Erste für eine Million“ nennt die SZ die US-Amerikanerin Naomi Girma, die für diese Summe vom Verein San Diego Waves zum britischen Traditionsclub FC Chelsea wechselt. Aber: nur nicht zu früh freuen. Der teuerste Spieler der Welt, momentan ist das der Norweger Erling Haaland, hat einen zweihundertfachen Marktwert. Da ist er also wieder, der Gender Pay Gap.
Doch selbst von einer Million können die Skispringerinnen nur träumen: Erst Ende letzten Jahres sorgte die Nachricht für Entrüstung, dass erfolgreiche Teilnehmer des Silvester-Springens in Garmisch-Partenkirchen rund 3200 Euro Prämie bekommen hatten. Die Teilnehmerinnen dagegen: Duschgel, Shampoo und Handtücher.
Grazie mille! Dem Team in Berlin, den Kolleginnen in Australien.