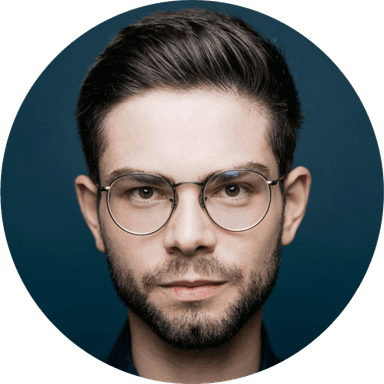Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerbenGuten Morgen. Allein in Berlin haben gestern nach Schätzung der Polizei 160 000 Menschen gegen eine Zusammenarbeit von CDU und AfD demonstriert, die meisten von ihnen auch gegen Friedrich Merz, den Kanzlerkandidaten der Union. Im ganzen Land hat es in den vergangenen Tagen solche Proteste gegeben. Diejenigen, die auf den Straßen unterwegs waren, bezogen sich zumeist auf die „Brandmauer“ zur AfD.
Diese sei durch das Verhalten der Union, die vergangene Woche eine parlamentarische Mehrheit mithilfe der AfD eingegangen war, in Gefahr. Manch einer sah sie schon eingerissen. In Berlin waren Parteien dabei, Gewerkschaften, Sozialverbände und Kirchen. Auf der Bühne sprach auch der Publizist Michel Friedman, der vor wenigen Tagen aus der CDU ausgetreten war. „Unentschuldbar“ sei dieser Fehler der CDU, sagte Friedman bei der Kundgebung.
Die AfD sei eine „Partei des Hasses“ und mit solchen Feinden der Demokratie dürfe es keine Zusammenarbeit geben. Statt sich nun aber im Streit um die Migrationspolitik auf die CDU zu „stürzen“, die eine demokratische Partei bleibe, müsse es nun darum gehen, unter Demokraten „Kompromisse zu schließen, statt gegeneinander zu schießen“.
Merz betonte gestern Abend erneut, es gebe keine Zusammenarbeit mit der AfD. Auf eine Nachfrage, ob er AfD-Stimmen für eine Mehrheit in Kauf nehmen würde, antwortete er: „Nein.“ CSU-Chef Markus Söder spitzte im ZDF zu: „Natürlich bleibt die Brandmauer, härter denn je.“ In wenigen Stunden startet die CDU in ihren Wahlparteitag. Willkommen am Platz der Republik.
ANZEIGE
Was wichtig wird
Heute trifft sich die CDU in Berlin zum eintägigen Wahlparteitag. Es dreht sich alles um die Rede von Kanzlerkandidat Friedrich Merz und um ein „Sofortprogramm“ mit 15 Maßnahmen, das die 1001 Delegierten beschließen sollen. Eine weitere Frage wird sein, wie geschlossen die Parteibasis nach den Ereignissen im Bundestag hinter Merz steht. So viel sei gesagt: In der CDU erwarten sie keine Kontroversen auf offener Bühne, dafür aber weitere Proteste aus dem „linken Lager“.
Wohlstand und Sicherheit: Im Beschlussentwurf des 15-Punkte-Programms mit dem Titel „Unser Sofortprogramm für Wohlstand und Sicherheit“ listet die CDU auf zwei Seiten auf, welche politischen Maßnahmen sie unmittelbar nach der Regierungsübernahme umsetzen würde. Die Maßnahmen selbst passen auf eine Seite. Aufgeführt werden auch der umstrittene Fünf-Punkte-Plan zum Stopp der illegalen Migration von Merz, der im Bundestag beschlossen wurde, und das dort gescheiterte „Zustrombegrenzungsgesetz“. Damit stimmen die Delegierten auch über den neuen Asyl-Kurs der Union ab.
„Es ist Zeit, dass sich etwas ändert“, heißt es in dem Papier. Die Herausforderungen seien gewaltig, jeder Tag zähle. Der Ton: Je stärker die CDU werde, desto mehr Maßnahmen könne sie rasch auf den Weg bringen. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass sie derzeit auf SPD oder Grüne als Koalitionspartner angewiesen wäre. Das Programm ist in zwei Kapitel geteilt: „Vorrang für Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand“ mit neun Punkten und „Sicherheit für die Menschen in Deutschland“ mit sechs Vorschlägen.
Ampel-Rückbau: Die Forderungen sind weitestgehend dem Wahlprogramm entnommen. Etwa eine Senkung der Stromsteuer und Netzentgelte, der Rückbau von Bürokratie („weg mit der deutschen Lieferkettenregulierung“), eine wöchentliche Höchstarbeitszeit, steuerfreie Überstundenzuschläge, die Speicherung von IP-Adressen, elektronische Fußfesseln. Die CDU will auch wesentliche Projekte der Ampel zurückfahren. Konkret erwähnt werden in dem Papier Heizungsgesetz, „Express-Einbürgerung“ und Cannabis-Legalisierung.
Zwischen Schwarz und Grün knistert es gerade. Da sind die gegenseitigen Lügen-Vorwürfe zwischen Außenministerin Annalena Baerbock und Unions-PGF Thorsten Frei vom vergangenen Freitag, da sind die Reaktionen auf das Abstimmungsverhalten im Bundestag: Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck sprach mit Blick auf das Vorgehen von Friedrich Merz gar von einer „Disqualifikation“ für das Amt des Bundeskanzlers. Söder sagte gestern im ZDF mal wieder, auf die Grünen könne man nicht setzen: „Für mich ist Schwarz-Grün gerade wegen der Migrationsfrage echt tot.“
Die Nervosität ist hoch: Nicht so ganz dazu passen wollte eine Runde am Donnerstagabend, zu der CDU-Mann Armin Laschet eingeladen hatte. In seiner Wohnung waren unter anderem Merz dabei, Jens Spahn, Cem Özdemir, Annalena Baerbock und Katrin Göring-Eckardt. Verschiedene Medien machten daraus schnell ein schwarz-grünes Gipfeltreffen, obwohl auch Spitzenkräfte von FDP und SPD eingeladen waren. Laschet reagierte schnell auf X, betonte den privaten und überparteilichen Charakter des Events.
Auch sonst herrscht Vorsicht. Dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) kam gestern kein Wort der Kritik an Merz über die Lippen, kein Satz zur AfD. Es gebe inzwischen „einen großen gesellschaftlichen Konsens, dass bei der irregulären Migration etwas substanziell passieren muss“, sagte er der SZ. „Dafür stehen vor allem CDU und CSU.“ Er werbe weiterhin „für eine Allianz der Mitte in der Migrationspolitik“. Nun eben als Aufgabe nach dem 23. Februar. Mehr hier von Christian Wernicke und Christian Zaschke.
Genauer hingeschaut: „Es wird in der neuen Legislaturperiode Aufgabe der demokratischen Parteien sein, dieses Thema sachlich, ohne Hetze, im Ergebnis aber effektiv anzugehen“, sagte Wüst. Mona Neubaur, die grüne Vize-Ministerpräsidentin von NRW, nannte das Merz-Manöver einen „schweren Fehler“. „Mit Rechtsextremen macht man keine gemeinsame Sache, und man unterstützt auch keine Initiativen, die nur durch deren Zustimmung zustande gekommen sind. Darin sind wir innerhalb der Landesregierung klar.“ Ihr schwarz-grünes Machtwort war also abgestimmt mit Wüst.
Grünes Dilemma: Für die Grünen ist die Situation heikel. Sie wissen, dass die Union ihr einziger Partner nach der Wahl sein könnte. Von grüner Seite heißt es daher zurzeit immer wieder, Merz müsse in die Mitte zurückkehren, alle demokratischen Kräfte müssten miteinander bündnisfähig sein. Doch es gibt auch Grüne, die anders formulieren und eine schwarz-grüne Koalition im Bund infrage stellen. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt etwa. Er sagte der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung am Freitag, eine schwarz-grüne Koalition sei „alles andere als ein Selbstläufer“. Friedrich Merz sei im Moment „weder regierungsfähig noch der richtige Mann für unser Land“.
In der FDP haben sie ein neues Thema. Die Wirtschaftswende hat im Wahlkampf plötzlich nur die zweite Geige gespielt, die Liberalen dominierten nicht mehr die Schlagzeilen. Dann sind bei den Unions-Anträgen im Bundestag weite Teile der FDP-Fraktion mitgezogen. Das Signal: Schwarz-Gelb um jeden Preis, erst recht als harte Abgrenzung zu Rot-Grün. Die gemeinsame Mehrheit unter Inkaufnahme von AfD-Stimmen wurde aber zur Zerreißprobe für die Fraktion, nur zwei Drittel stimmten am Freitag zu. Man will nun aber trotzdem umsetzen, was in der Ampel lange nicht möglich war.
Den Kurs fährt Lindner konsequent fort. „Die FDP wird nach der Bundestagswahl nicht in eine Regierung zusammen mit den Grünen eintreten“, sagte er am Wochenende im Interview mit der FAS. Schwarz-Gelb wäre, sagte Lindner, eine „Reformregierung der Mitte“ und eine Deutschlandkoalition „immerhin besser als Schwarz-Grün“. Es passt zum Manöver von Fraktionschef Christian Dürr: Er versuchte am Freitag zu vermitteln, vor allem aber die SPD von den Grünen zu lösen, um eine Abstimmung mit der AfD zu verhindern.
Ohne Erfolg. Viel Spitzenpersonal, darunter etwa PGF Johannes Vogel, blieb der zweiten Abstimmung fern; die Fraktion ist nicht mehr geschlossen. Die Abgeordnete Anikó Glogowski-Merten stimmte – so wie Ulrich Lechte, der Merz als „Zauberlehrling“ bezeichnete – sogar mit Nein. „Natürlich muss migrationspolitisch etwas passieren, da sind wir uns alle einig. Aber ich lasse mich von Friedrich Merz nicht in eine solche Situation hineintreiben, mit der AfD zusammen solche Beschlüsse zu fassen“, sagte Glogowski-Merten der Braunschweiger Zeitung. Die Jungen Liberalen und andere aus der Partei hätten ihre Entscheidung gut gefunden.
Auf in die nächste Schlacht: Die Abweichler sorgten wiederum für großen Frust bei Abgeordneten wie Wolfgang Kubicki. Was die Inhalte angeht, sind sie sich aber alle recht einig: „Ich hätte diesen Gesetzentwurf der Union nicht empfohlen, einzubringen. Aber wenn eine Frage gestellt wird, dann beantworten wir die“, sagte Lindner gestern dem ZDF. Die Abweichler hätten sich am Verfahren gestört, nicht am Inhalt, weil dadurch die AfD aufgewertet worden sei. Wie der Stern berichtet, schrieb Lindner in einer Chatgruppe, er könne Enttäuschungen über das Abstimmungsverhalten verstehen: „Jetzt sollten wir uns in die Deutungsschlacht einschalten. Ich gebe jedenfalls nicht auf.“
Finanzminister Jörg Kukies hat vor einer verfrühten Panikreaktion auf drohende Strafzölle durch die USA und ihren Präsidenten Donald Trump gewarnt. „Auf die ersten Entscheidungen sollte man nicht panisch reagieren, sondern sie als Anfang der Verhandlungen betrachten und nicht als Ende“, sagte Kukies gestern laut FAZ vor deutschen Wirtschaftsvertretern in Riad.
Die Trump-Zölle kommen: Am Wochenende hatte Trump Anordnungen unterzeichnet, mit denen ab morgen Strafzölle in Höhe von zehn Prozent auf alle Importe aus China erhoben werden. Für Einfuhren aus Mexiko und Kanada gelten sogar 25 Prozent. Einzige Ausnahme: Für Energieimporte aus Kanada soll ein Satz von zehn Prozent gelten. Ottawa hat bereits Gegenzölle angekündigt, Peking will unter anderem eine Klage bei der Welthandelsorganisation einreichen, warnte vor einem „Handels- oder Zollkrieg“. Was die neuen Zölle für Deutschland bedeuten, ordnet heute unser Dossier Geoökonomie ein.
Trump hatte auch der EU gedroht. Wie SPD-Mann Kukies betonte, versuche die Bundesregierung jedoch, einen konstruktiven Ansatz aufrechtzuerhalten und entsprechende Signale nach Washington zu senden. Bereits am Samstag hatte er gefordert, man müsse mit den USA „ganz offen über ein Freihandelsabkommen sprechen“. Sein Vorschlag: Deutschland könne Öl, Gas und möglicherweise auch grünen und blauen Wasserstoff aus den USA importieren. Auch Europa hatte Trump mit Zöllen gedroht.
Auf der Suche nach Handelspartnern: Kukies befindet sich bis Dienstag auf Delegationsreise in der Golfregion, wo er für wirtschaftliche Zusammenarbeit wirbt: „Wir brauchen mehr offene Handelspartner, wenn man sieht, dass in anderen Regionen das Klima etwas rauer wird, was die Offenheit der Märkte angeht“, sagte er. Damit meinte er in erster Linie die USA und China. In der Golfregion finde derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen statt, wer dort der größte Handelspartner sei. So oder so gebe es ein großes Wachstumspotenzial.
ANZEIGE
Tiefgang
Jessica Rosenthal ist noch nicht ganz in der richtigen Stimmung für das, was sie gleich vorhat. Zu aufgewühlt ist sie von den Ereignissen am Freitag im Bundestag, davon, dass die Union gemeinsam mit der AfD für das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz gestimmt hat. „Ich verstehe die Welt nicht mehr“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete.
Erst am Morgen ist sie aus Berlin zurück nach Bonn in ihre Heimat geflogen. Jetzt, am Samstagmittag, hat sie sich mit drei Verbündeten in einem Wohngebiet zum Haustürwahlkampf verabredet. Wenn sie gleich an den Haustüren der Menschen klingelt, muss sie ihre Wut verbergen, jetzt heißt es: freundlich sein.
Für die einstige Chefin der Jusos geht es in diesen Tagen um nicht weniger als die Fortsetzung ihrer politischen Karriere. Seit 2021 sitzt sie im Bundestag, ob sie das auch nach der Wahl am 23. Februar noch tun wird, ist äußerst fraglich. Auf der Landesliste der SPD in Nordrhein-Westfalen taucht ihr Name erst auf Rang 34 auf. Aller Voraussicht nach wird das nicht für einen Sitz im Parlament reichen. Die 32-Jährige muss das Direktmandat gewinnen, andernfalls droht ihr das Aus.
2021 war es ein enges Rennen in Bonn: Rosenthal verlor knapp gegen Katrin Uhlig von den Grünen, am Ende machten 216 Stimmen den Unterschied. Dieses Jahr ist die Situation anders: Die Umfragewerte der SPD sind schlecht, und mit dem Virologen Hendrik Streeck schickt die CDU einen politisch zwar unerfahrenen, aber prominenten Gegner ins Rennen. Das YouGov-Wahlmodell sieht den CDU-Mann derzeit deutlich vor Grünen und SPD, die nahezu gleichauf liegen. Rosenthal braucht also jede Stimme.
Um diesem Ziel näher zu kommen, haben sie und ihr Team sich dieses Mal die Straßen auf dem Brüser Berg im Bonner Stadtbezirk Hardtberg ausgesucht. Hier mischen sich kleine Reihenhäuschen unter mehrgeschossige Wohnanlagen, der Altersdurchschnitt der Bevölkerung sei eher hoch, sagt Rosenthals Mitarbeiter, außerdem lebten hier viele Menschen mit Migrationshintergrund. Eine Gegend mit SPD-Potenzial also.
Rosenthal klingelt an der ersten Tür, eine Frau öffnet. Die SPD-Bewerberin stellt sich kurz vor, sagt, sie wolle, dass die Anwohnerin sie auch einmal in echt gesehen habe. Und auch, dass sie sich über ihre Unterstützung bei der Wahl freuen würde. Dann drückt sie der Frau einen Flyer in die Hand und verabschiedet sich. Ein kurzes „Hallo“, mehr ist es nicht.
Laut den Strateginnen und Strategen in der SPD-Parteizentrale ist der Haustürwahlkampf „nachweislich der effektivste Weg, um SPD-nahe Menschen dazu zu bewegen, am Wahltag oder per Briefwahl ihre Stimme für die SPD abzugeben“. So steht es in einem parteiinternen Handbuch für Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Es gehe dabei weniger darum, Menschen zu überzeugen, sondern darum, sie zu mobilisieren. Lange Gespräche sind nicht vorgesehen, stattdessen soll der Besuch „nach wenigen Minuten freundlich enden“.
Während Rosenthal klingelt, führt ihr Mitarbeiter Buch. In einer App der SPD wählt er den Straßenabschnitt aus, in dem sie unterwegs sind, vermerkt, ob die Tür geöffnet wurde und wie die Stimmung war. Zwischen „Gut“, „Mittel“ und „Schlecht“ kann er dabei wählen. An der sechsten Tür trifft die SPD-Bewerberin eine ältere Frau an, wieder stellt sich Rosenthal vor, übergibt ihren Flyer. „Ich lese es mir durch“, sagt die Dame, Briefwahl habe sie schon beantragt. Stimmung „Mittel“ trägt ihr Mitarbeiter ein.
Damit Rosenthal Chancen auf das Direktmandat hat, müsste die SPD bundesweit noch in den Umfragen zulegen. Ob Olaf Scholz dabei eine Hilfe ist? „Wer die letzte Woche aufgepasst hat, wird schon wissen, was er an Olaf Scholz hat“, sagt Rosenthal. Friedrich Merz' Bohren an der Brandmauer scheint die Genossen offenbar motiviert und zusammengeschweißt zu haben.
Schließlich hat sich die einstige Juso-Chefin in der Vergangenheit mehrmals auf Konfrontationskurs zum Kanzler begeben: Rosenthal kritisierte den Flüchtlingskurs der Bundesregierung, ging auf Distanz zum Sondervermögen für die Bundeswehr und stimmte im vergangenen Oktober gegen die Verschärfungen des Asylrechts. Jetzt sagt sie: Scholz würde für sein eigenes Ego nicht das Wohl des Landes gefährden. Soll heißen: anders als Friedrich Merz.
Dann kommen die SPD-Wahlkämpfer an einen Wohnblock. Rosenthal klingelt – vergeblich. Ein Mann mit schwarzer Sonnenbrille schiebt sein Fahrrad aus der Tür, am Lenker baumelt eine Tüte mit Plastikflaschen. „Wenn ihr da einfach so reingeht, ist das Hausfriedensbruch“, sagt er. Ein paar Meter weiter bleibt er stehen und beobachtet die Genossen. „Deswegen klingeln wir ja“, sagt Rosenthal. Er könne warten, entgegnet der Mann. Kurz darauf aber zieht er weiter. „Stimmung schlecht“, sagt Rosenthal.
Wenige Augenblicke später öffnet schließlich jemand die Pforte, die SPD-Politikerin geht die Treppenstufen hinauf, klappert eine Wohnung nach der anderen ab. Wer nicht zuhause ist – oder nicht öffnet – dem hängt sie ihr Werbematerial an die Türklinke.
Zwischen 60 und 70 Türen werden es an diesem Nachmittag sein. Ein guter Schnitt sei das für eine Stunde, sagt ihr Mitarbeiter. Etwa ein Drittel habe geöffnet. Bis zu ihrem Ziel ist es also buchstäblich noch ein weiter Weg für Jessica Rosenthal. Tim Frehler
Fast übersehen
Wahlkampfauftakt: BSW-Chefin Sahra Wagenknecht beginnt heute ihre Wahlkampftour. Um 17:30 Uhr tritt Wagenknecht auf dem Münchner Marienplatz auf. Danach folgen acht weitere Stationen im gesamten Bundesgebiet. Der Abschluss soll am 20. Februar vor dem Brandenburger Tor stattfinden.
Kampf um fünf Prozent: Wagenknecht muss aufholen. Sowohl der Deutschlandtrend der ARD als auch das ZDF-Politbarometer sahen das BSW vergangene Woche bei vier Prozent und damit nicht im Bundestag vertreten. Zwar bescheinigten einige Institute der Wagenknecht-Partei zuletzt auch Umfragewerte von fünf und sechs Prozent. Klar ist aber: Es wird eng.
Was helfen soll: Frieden, Wagenknechts Hauptthema, ist derzeit kaum Bestandteil der öffentlichen Debatte. Die Parteichefin versucht nun offenbar andere Themen in den Vordergrund zu stellen. Bei ihrer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag sagte sie, Trumps Pläne zur Umsiedlung von Menschen aus dem Gaza-Streifen seien „ungeheuerlich“. Außerdem sagte Wagenknecht, das Thema Mieten gehöre in den Mittelpunkt des Wahlkampfes. Damit wirbt aber derzeit vor allem ihre ehemalige Partei, die Linke.
Entschuldigung ausgeschlagen: Die Entschuldigung des rbb für eine fehlerhafte Berichterstattung über Vorwürfe gegen seine Person will der Grünen-Abgeordnete Stefan Gelbhaar vorerst nicht annehmen. „Man kann sich erst entschuldigen, wenn man die Fehler aufgearbeitet hat“, sagte Gelbhaar der Berliner Zeitung. Gegen Gelbhaar waren im Dezember Vorwürfe der sexuellen Belästigung bekannt geworden. Besonders schwerwiegende Anschuldigungen haben sich jedoch als gefälscht herausgestellt.
Verunsicherungen im persönlichen Umfeld: Sieben Personen halten gegenüber einer Ombudsstelle der Grünen gemachte Angaben aufrecht. Gelbhaar habe von der Stelle erfahren, dass es um „subjektives Unwohlsein“ gehen soll, um „Eindrücke“, sagte er. Da sei es „unheimlich schwer, überhaupt von Schuld oder Unschuld zu sprechen“. Er habe schon länger Einschüchterungen in seinem persönlichen Umfeld beobachtet. „Ich weiß, dass seit über einem Jahr Menschen aus meinem Umfeld mit Nachrichten in Bezug auf meine Person verunsichert werden.“
Erhebliche Straftaten: „Wer da die Quelle ist, wird sich hoffentlich noch herausstellen“, sagte Gelbhaar. Er sei Opfer „erheblicher Straftaten“ geworden. „Wenn diese falschen, krassen Behauptungen dann noch dermaßen breit in der Öffentlichkeit, im eigenen Umfeld, im weiteren Umfeld, überall diskutiert werden – das macht dich kaputt“, sagte er. Sein politischer Lebensweg sei entwertet, die Berichterstattung des rbb habe leider massiv damit zu tun. Gelbhaar hatte alle Vorwürfe stets bestritten.
Die nächste Debatte: Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat höhere Verteidigungsausgaben von Deutschland verlangt und mehr Rüstungsproduktion gleich dazu. „Deutschland muss die Rüstungsausgaben erhöhen, das wird notwendig sein“, sagte Rutte der Bild am Sonntag. Gleichzeitig müsse Berlin die Produktion hochfahren. Das werde die Debatte in den nächsten Monaten sein, in vielen europäischen Ländern.
Si vis pacem, para bellum: „Wir müssen uns auf Krieg vorbereiten. Das ist der beste Weg, um Krieg zu vermeiden“, sagte Rutte. Die Deutschen hätten seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine viel richtig gemacht. „Angesichts der Größe der deutschen Wirtschaft wollen wir natürlich, dass sie noch viel mehr tun“, sagte er. Die Nato-Verbündeten würden in den kommenden Monaten über die Bemessung der Ausgaben entscheiden: „Ich kann ihnen aber eins versichern: Es wird viel, viel, viel mehr sein als zwei Prozent.“
Schrumpfende Streitkräfte: Derweil ist die Zahl der Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr trotz zunehmender Einstellungen erneut gesunken. Zum Jahresende habe es rund 181 150 Frauen und Männer in Uniform gegeben, hieß es aus dem Verteidigungsministerium gegenüber der dpa. Im Jahr zuvor waren es noch rund 181 500 gewesen. Einen Rückgang gab es demnach hauptsächlich bei Zeitsoldaten, während bei Berufssoldaten und Wehrdienstleistenden ein leichtes Plus verzeichnet wird. Die Zielgröße liegt bei 203 000 Soldaten.
Unter eins
Frank-Walter Steinmeier über den früheren Bundespräsidenten Horst Köhler, der am Samstagmorgen im Alter von 81 Jahren verstorben ist
Zu guter Letzt
Nächste Woche ist Valentinstag. Die Liebe spielt derzeit auch in dem ein oder anderen Interview eine Rolle: So kam der Bundeskanzler im Zeit-Podcast „Alles gesagt“ geradezu ins Schwärmen, als es um seine Frau Britta Ernst ging: „Liebe ist das Wichtigste. Und das hilft. Immer!“, sagte Scholz. Sollte er nicht wiedergewählt werden, werde er sich „schon zu beschäftigen wissen und ein schönes Leben mit meiner Frau haben“.
Einige Beispiele für gemeinsame Tätigkeiten hatte er auch parat: Wandern, auf Konzerte gehen; ins Kino oder Theater, aber eher selten. Als er die ehemalige Landesministerin kennengelernt habe, rechnete Scholz zunächst nicht damit, dass sie sich für ihn als Mann interessiere. „Weil sie so toll war und ist.“ Auch bei Merzens scheint es gut zu laufen. Charlotte Merz, Ehefrau des Unions-Kanzlerkandidaten, gab der Westfalenpost ein seltenes Interview: „Was da von einigen über das Frauenbild meines Mannes geschrieben wird, stimmt ganz einfach nicht, ich kann es in keinster Weise nachvollziehen“, sagte die Richterin.
Das Familien- und Eheleben sei von Anfang an gleichberechtigt gewesen. „Wir haben beide Rücksicht auf den Job des anderen genommen und die Kinderbetreuung so aufgeteilt, dass sie mit unseren beruflichen Verpflichtungen vereinbar war“, sagte Merz. Das soll auch so bleiben. Sollte ihr Mann ins Kanzleramt einziehen, will Charlotte Merz im Sauerland bleiben. „Ich möchte ganz normal jeden Morgen zur Arbeit fahren. Auch, weil ich davon ausgehe, dass mein Mann deutlich weniger Zeit im Sauerland verbringen kann, wenn er Kanzler wird“, sagte Merz.
Grazie mille! Dem Team in Berlin, den Kolleginnen in Australien.