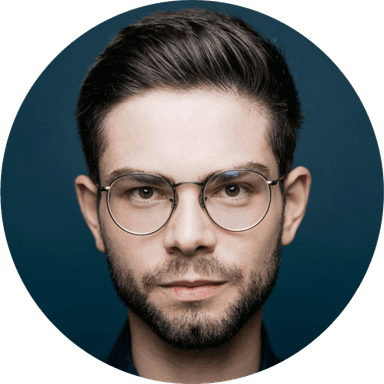Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerben
Wer am Sonntag zittern muss
Donnerstag, 20. Februar 2025Guten Morgen. Um die Ukraine ging es kaum beim letzten TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Die Sendung bei Welt TV und Bild war bereits am Nachmittag in der Berliner Axel-Springer-Zentrale aufgezeichnet worden. Wie es vor Ort hieß, habe man sich auf kontroversere Themen konzentrieren wollen und bei dem Thema gebe es zwischen den Kandidaten nun mal leider nicht so viel Konfliktpotenzial.
Dass US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij einen „Diktator ohne Wahlen“ nennen sollte, hatten die Moderatoren des Duells noch nicht auf dem Schirm: Es geschah erst Stunden später. Stattdessen ging es um die Wirtschaft, ums Bürgergeld, um die innere Sicherheit. Themen also, die sich hier im Land abspielen, wie die Moderatoren im Gespräch mit anwesenden Medienschaffenden betonten.
All das hing etwas schief, als es parallel zur Ausstrahlung zur Hauptsendezeit um ein ganz anderes Thema ging. „Es ist schlicht falsch und gefährlich, Präsident Selenskij die demokratische Legitimation abzusprechen“, sagte Scholz am Abend dem Spiegel. „Das ist vollkommen absurd“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock dem ZDF. Dass mitten im Krieg keine ordentlichen Wahlen abgehalten werden können, entspreche den Vorgaben der ukrainischen Verfassung, betonte der Kanzler. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es hier.
Wir blicken heute auf frische Zahlen zur Bundestagswahl, auf BSW und Linke und auch auf einige denkwürdige Momente des TV-Duells. Willkommen am Platz der Republik.
ANZEIGE
Was wichtig wird
Kurz vor dem Wahltag kommt noch einmal Bewegung in die politische Stimmung: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden die Unionsparteien nur noch 197 von 299 Wahlkreisen gewinnen. Die SPD springt von 25 auf 44 Wahlkreise. Zu diesem Ergebnis kommt das neue und finale YouGov-Wahlmodell, das SZ Dossier vorab vorliegt. Anfang des Monats hatte das Modell noch 221 Wahlkreise für CDU und CSU geschätzt. In 72 Wahlkreisen ist das Rennen noch eng.
Die Ergebnisse im Detail: Die Union gewinnt in 197 Wahlkreisen (-24 gegenüber der Umfrage zu Monatsbeginn), die AfD in 47 Wahlkreisen (-1), die SPD in 44 Wahlkreisen (+19), die Grünen in sieben Wahlkreisen (+4), die Linke in vier Wahlkreisen (+2). Die Ergebnisse wurden anhand eines statistischen Modells geschätzt, das auf Daten von Befragungen beruht. Es berechnet die derzeitige Wahlabsicht nicht nur national, sondern auch für die Wahlkreisebene. Dabei betrachtet das Modell 72 Wahlkreise als unentschieden – davon tendieren derzeit 27 zur Union, 29 zur SPD, sieben zur AfD, sieben zu den Grünen und zwei zur Linken.
Der neue Bundestag: Das Modell sieht die Union auf Platz eins bei 29,9 Prozent und die AfD dahinter mit 19,7 Prozent. Es folgen SPD mit 15,6 und Grüne mit 12,7 sowie die Linke mit 7,5 Prozent. Nicht im Bundestag wären BSW mit 4,6 und FDP mit 4,5 Prozent. Im neuen Bundestag kämen CDU und CSU auf 220 Sitze, die AfD auf 145 Sitze, die SPD auf 115 Sitze, die Grünen auf 94 Sitze und die Linke auf 55 Sitze. Der SSW wird mit einem Sitz angeführt. Damit würden Union und SPD auf 335 von 630 Stimmen kommen, Schwarz-Grün hätte mit 314 Sitzen keine Mehrheit. Das Wahlmodell wurde für die Leserinnen und Leser vom Platz der Republik bereits hier freigeschaltet.
Zur Methodik: Das Meinungsforschungsinstitut verwendet ein „Mehrebenen-Regressionsmodell mit Poststratifikation“. Es wurde mit einer Stichprobe von 9 281 wahlberechtigten Mitgliedern aus dem Panel gefüttert, um Beziehungen zwischen den Merkmalen von Wählerinnen und Wählern und Wahlabsicht zu ermitteln. In einem zweiten Schritt wurden diese Beziehungen genutzt, um die politische Stimmung in Bundesländern und Wahlkreisen zu schätzen (mehr dazu hier). Berichtet werden wahrscheinliche Ergebnisse aus einer Reihe von möglichen Ergebnissen; die Interviews wurden im Zeitraum 07.02. bis 19.02.2025 geführt.
Die Wartezeit auf Sahra Wagenknechts Auftritt konnten sich die rund eintausend Menschen, die gestern Abend in die Niedersachsenhalle nach Hannover gekommen waren, mit Friedensliedern vertreiben. Der Mann mit der Gitarre auf der Bühne hatte auch den passenden Appell mitgebracht. Es sei wichtig, dass das BSW in den Bundestag komme, „damit es dort eine Friedensstimme gibt“.
Auftritt Wagenknecht: Damit waren die beiden zentralen Probleme des BSW benannt. Ob die Partei in den Bundestag einzieht, ist fraglich. Und Frieden, Wagenknechts Leib- und Magenthema, spielte in diesem Wahlkampf kaum eine Rolle. Zumindest in der Niedersachsenhalle galt das gestern Abend nicht. Weite Teile ihrer Rede widmete Wagenknecht ihrem Lieblingsthema. Tim Frehler hat ihr zugehört.
Was auf dem Spiel steht: Nach Wagenknechts Rede erhob sich das Publikum und applaudierte, die BSW-Chefin posierte für Selfies. Die Halle in Hannover feierte sie, die Umfragen plagen sie. Und längst hat sie ihre politische Zukunft daran geknüpft, ob das BSW in den Bundestag einzieht. Das ist jetzt ihre persönliche Fallhöhe.
Die Bilanz: Aus ihrer Sicht sei der Wahlkampf aber gut gelaufen, sagte Wagenknecht im Gespräch mit SZ Dossier. „Das, was wir mit unseren Mitteln machen konnten, haben wir maximal ausgeschöpft.“ Mehr Veranstaltungen hätte das BSW nicht finanzieren können. Über Themen wie Altersarmut, Kriegsgefahr oder zu hohe Energiekosten habe man gesprochen und Konzepte vorgelegt.
Schuld sind die anderen: Gerade in den vergangenen Wochen sei es im Wahlkampf monothematisch fast nur um Migration gegangen. „Da haben wir zwar eine klare Position, aber für die allein werden wir nicht gewählt, denn das vertritt mindestens die Union inzwischen auch“, sagte Wagenknecht. Über Umfragen werde den Menschen zudem der Eindruck vermittelt, eine Stimme für das BSW sei womöglich verschenkt, nicht erwähnt werde, dass das BSW in Umfragen auch über fünf Prozent stehe.
Und dann waren da noch die Landtagswahlen: „Für die Bundestagswahl wäre es natürlich besser gewesen, wir wären überall in der Opposition geblieben“, sagte Wagenknecht. Angesichts der Wahlergebnisse hätten es viele Wähler dem BSW aber auch übelgenommen, wenn die Partei aus Prinzip nicht in eine Regierung eingetreten wäre. „Da waren wir natürlich in einem Dilemma.“ Aber gerade die Thüringer Koalition mit der CDU sei bei einem Teil ihrer Wähler nicht gut angekommen.
Die Verantwortung: Vom kommenden Sonntag hängt allerdings nicht nur Wagenknechts Karriere ab, sondern auch die ihrer Mitstreiter, gar der Fortbestand der Partei, die sie gegründet hat und die ihren Namen trägt. Wagenknecht trägt die Verantwortung, wenn die Sache scheitert. Wie geht sie damit um? „Ich kann mir sagen, ich habe alles gemacht, was ging. In den letzten Wochen bin ich über die Grenzen dessen hinausgegangen, was man eigentlich gesundheitlich schafft.“ Darüber, was aus der Partei werde, sollte sie den Einzug verfehlen, wolle sie eigentlich nicht nachdenken.
Im Rennen der kleinen Parteien auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl setzt sich die Linke vom Schlussfeld ab: Die Umfragen der vergangenen Tage sehen die Partei bei sieben bis neun Prozent, berichtet Elena Müller. Damit würde sie sicher über die Fünf-Prozent-Hürde kommen. Zudem scheinen mindestens vier Kandidierende eine Chance zu haben, ihren Wahlkreis direkt zu gewinnen, wie die Berechnungen von YouGov zeigen.
Besonders bei jungen Menschen beliebt: Die Linke ging klar als Gewinnerin der U18-Wahl hervor (SZ Dossier berichtete) und überzeugt auch die 18- bis 29-Jährigen. Manch einer lässt sich gar zu dem Gedanken hinreißen, der Aufschwung lasse eine rot-grün-rote Koalition möglich erscheinen: Wenn nur junge Menschen wählen dürften, hatte Grün-Rot-Rot eine eindeutige Parlamentsmehrheit, verlautbart Der Westen: „So wäre eine Regierungskoalition möglich, sogar mit einem Kanzler Robert Habeck.“
Fokus auf Gerechtigkeit: Ein Faktor für den Erfolg ist sicher der Wunsch vieler Wählerinnen und Wähler nach einer anderen Themensetzung. Im Wahlkampf hatten sich Union, SPD und AfD zuletzt stark auf das Thema Migration fokussiert. Die Grünen versuchten es zum Schluss immerhin mit einer Rückbesinnung auf ihre Wurzeln und brachten das Klima wieder ins Rennen. Soziale Gerechtigkeit blieb aber erkennbar allein ein Fokus der Linken. Auch wenn sich die frühere Linke Sahra Wagenknecht mit ihrem BSW anzuschließen versuchte.
Die Macht von Social Media: Sprach man bislang der AfD zu, mit ihren Kampagnen in den sozialen Netzwerken besonders erfolgreich zu sein, hat die Linke dort aufgeholt. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Bundestagsrede der Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek zur Migrationsdebatte. Der Clip wurde im Netz mindestens 29 Millionen Mal angeklickt, die Linke bekam Aufwind und baute diesen weiter aus.
Freude im Karl-Liebknecht-Haus: „Wir haben mit unserer Neuaufstellung ein klares Profil gewonnen und das wollen wir auch mit klaren Botschaften auf Social-Media vermitteln“, sagt Janis Ehling, Bundesgeschäftsführer der Partei, SZ Dossier. Zum Erfolg der Partei gen Ende des Wahlkampfes fügte Ehling hinzu: „Die Stimmung steigt, die Hoffnung kehrt zurück. Die Leute merken, dass wir eine klare Haltung haben, dass wir kämpfen – und dass es wieder Spaß macht, links zu sein.“
Der Bundestag verliert Digitalkompetenz. Tabea Rößner (Grüne), Manuel Höferlin (FDP) und Anke Domscheit-Berg (Linke) erleben ihre letzten Tage als Abgeordnete. Ihr gemeinsames Fazit: Damit die Digitalisierung in Deutschland gelingt, braucht es ein Umdenken – sowohl in der Bundesregierung als auch im Bundestag. Matthias Punz von unserem Dossier Digitalwende traf die drei zu einem Abschiedsgespräch und einer kleinen Reise durch die Geschichte der deutschen Digitalpolitik.
Träge Debatten: „Es ärgert mich, dass die politischen Prozesse bei uns so lange dauern – vor allem im digitalen Bereich“, sagte Höferlin. „Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt etwas Neues machen muss.“ Themen würden jahrelang diskutiert, während sich die Technik rasant weiterentwickelt. Das Ergebnis: „Wir diskutieren oft Dinge, die von vorgestern sind.“ Seine Forderung: „Wir müssen auch im Bundestag ganz anders zusammenarbeiten, projektbezogener zum Beispiel.“
Konkrete Konzepte: Eine Lektion, die Rößner aus der laufenden Legislaturperiode mitnimmt, ist, Ideen in Koalitionsverträgen mit konkreten Konzepten zu unterfüttern. Sonst gebe es später unterschiedliche Auffassungen darüber, was eigentlich gemeint ist. „Das erst nach den Koalitionsverhandlungen zu machen, funktioniert nicht.“ Auch Bund und Länder sollen neue Wege gehen: „Was sich durch alle Bereiche zieht: Zu viele Akteure sind zuständig“, sagte Rößner. Als Beispiel nannte sie die Bereiche Datenschutz und Cybersicherheit.
Es gab aber auch schöne Momente: „Die Corona-Warn-App war ein Highlight für uns alle“, sagte Domscheit-Berg. „Für einen Moment lang konnte man sich vorstellen, dass wir wirklich in eine neue Zeit der Softwareentwicklung eintreten, wie es Helge Braun damals angekündigt hat.“ Die Regierung habe verschiedenste Akteure aus der Wissenschaft und Zivilgesellschaft eingebunden, sagte Rößner. Das sollte bei großen Digitalvorhaben und der Entwicklung von Anwendungen immer so sein.
Das vollständige Interview mit den drei scheidenden Abgeordneten ist gestern in unserem Dossier Digitalwende erschienen.
ANZEIGE
Tiefgang
Friedrich Merz hat jüngst FDP-Chef Christian Lindner mit der Aufforderung erzürnt, die Anhängerinnen und Anhänger der Liberalen sollten doch taktisch wählen: „Vier Prozent sind vier Prozent zu viel für die FDP“ sagte der Kanzlerkandidat der Union und warb damit, die Stimme lieber seiner Partei zu geben. Denn, so Merz' Argumentation: Wer am kommenden Sonntag die FDP wählt, verschenkt womöglich seine Stimme, wenn die Liberalen es nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen.
Die FDP hingegen setzt im Wahlkampfendspurt darauf, ihre prekäre Lage als besonders gutes Angebot unter die Leute zu bringen. Nach dem Motto: Eine Stimme für die FDP kann wirklich einen Unterschied machen. Wenn die FDP bei 4,99 Prozent liege, komme es auf jeden an, sagte Lindner am Mittwoch bei einem Auftritt in Bonn, wie mein Kollege Peter Ehrlich berichtet: „Wenn Ihre Stimme den Ausschlag gibt auf fünf Prozent, so einen Deal kann Ihnen keine andere Partei anbieten.“
Stimmen von anderen Wählergruppen anzuwerben, ist keine neue Taktik. Auch in der Vergangenheit ging es bei Wahlen um „Leihstimmen“, mit denen Anhängerinnen und Anhänger eines Lagers einer bestimmten Partei helfen, in den Bundestag einzuziehen und so bestimmte Koalitionen wahrscheinlicher zu machen. So wie 1994, als taktische CDU-Wähler bereits einmal der FDP zum Einzug verhalfen.
Doch dieses Mal kann man sich in den ganzen taktischen Überlegungen auch verlieren, denn den klassischen Lagerwahlkampf früherer Jahre mit den beiden Volksparteien CDU und SPD und einer starken FDP gibt es nicht mehr. Am Sonntag könnten theoretisch sieben Fraktionen in das Parlament einziehen, auch wenn die Umfragen dem BSW keine großen Chancen ausrechnen und nur wenige Institute die FDP klar über der Schwelle sehen.
So wird es schwieriger, die Koalitionsoptionen vorauszusagen. Kommt von den kleinen Parteien nur die Linke ins Parlament, reicht der Union wahrscheinlich ein Koalitionspartner. Schaffen es BSW oder FDP doch, wird wohl ein Dreierbündnis nötig, um die Mehrheit von 316 Sitzen zu erreichen.
Um für klarere Verhältnisse zu sorgen, fordert die linke Kampagnenplattform Campact dazu auf, lieber keine Kleinstparteien wie Volt, die Partei oder die Piraten zu wählen, weil diese Stimmen ohnehin „verschenkt“ seien. Das schwäche SPD, Grüne und Linke, argumentiert Campact, und stärke einen „Rechtsruck“: CDU und AfD würden davon bei der Sitzverteilung im Parlament überdurchschnittlich profitieren. Bei der Bundestagswahl 2021 seien durch die Wahl der Kleinstparteien vier Millionen Stimmen „verloren“ gegangen.
Ohnehin ist Vorsicht geboten, denn die Umfrageergebnisse der Wahlforschungsinstitute sind immer Annäherungen. Und selbst wenn man sich für eine taktische Wahl entscheidet, ist nicht vorhersehbar, ob es eine ausreichende Zahl anderer Menschen auch tut.
Die Entscheidung falle an der Wahlurne, nicht vorher: Das ist ein Argument, das Olaf Scholz (SPD) immer wieder bemüht. Wie bei der Wahl 2021 könne sich auf den letzten Metern noch einiges drehen, darauf hoffte der Kanzler bis noch kürzlich stoisch.
Taktisch wählen kann man auch mit dem sogenannten Stimmensplitting, also indem man Erst- und Zweitstimme unterschiedlichen Parteien gibt, weil man das Ergebnis des Direktmandates beeinflussen will. So ist vermehrt davon zu hören, dass der eine oder die andere darüber nachdenkt, im eigenen Wahlkreis der Person die Stimme zu geben, die die größten Chancen hat, gegen einen aussichtsreichen AfD-Kandidaten zu gewinnen. Auch wenn das hieße, im Zweifelsfall gegen die eigene Überzeugung zu wählen.
Doch auch das Stimmensplitting ist riskant. Wenn eine Wählerin oder ein Wähler die Erststimme an eine Partei und die Zweitstimme an eine andere Partei gibt, kann das nach dem neuen Wahlrecht der Partei des Direktstimmenmandats schaden. Denn nach der Reform, die den stetig wachsenden Bundestag wieder verkleinern soll, fallen die sogenannten Ausgleichs- und Überhangmandate weg. Direktmandate, die nicht über die Zweitstimme gedeckt sind, verfallen.
Deshalb werben die Parteien auf ihren Plakaten zum Schluss noch einmal mit der Forderung, beide Stimmen an sie zu vergeben. Elena Müller
Fast übersehen
Neue Pöbelvorwürfe gegen Olaf Scholz: Der Kanzler soll bei einem vertraulichen Abendessen im Kanzleramt Ende Januar 2024 gegenüber Kritikern ausfällig geworden sein. Der Grünen-Politiker Sebastian Schäfer erhob bei Politico den Vorwurf, der Kanzler habe Kritik an seiner Ukraine-Politik als die Argumentation „antipatriotischer Provinz-Arschlöcher“ bezeichnet.
Die Provinz schlägt zurück: Der Haushaltspolitiker Schäfer aus dem baden-württembergischen Esslingen behauptet gegenüber dem Medium, er habe den Kanzler damals aufgefordert, „dass die Unterstützung für die Ukraine in das Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eines Landes zu setzen sei“. Scholz sei daraufhin verbal entgleist. Der Grüne bestätigte diese Darstellung auch gegenüber dem Tagesspiegel. Teilnehmer, die an dem Abend ebenfalls im Kanzleramt waren, bestätigten dem Medium Schäfers Darstellung.
Tiefschlag vor der Wahl? Erst in der vorigen Woche war Scholz wegen eines Kommentars über den Berliner Kultursenator Joe Chialo in die Kritik geraten, musste sich Rassismus vorwerfen lassen. Dass die Situation im Kanzleramt, die sich bereits vor einem Jahr zugetragen hatte, nur wenige Tage vor der Wahl öffentlich wurde, kommentierte ein Regierungssprecher gegenüber Politico am Mittwoch mit dem bekannten Zitat von Michelle Obama: „When they go low, we go high.“ (Oder was man im Kanzleramt für das eine und das andere hält.)
Woher kam das Geld? Knapp 2,35 Millionen Euro hat die AfD in diesem Wahlkampf vom Österreicher Gerhard Dingler erhalten, gespendet in Form von mehr als 6000 Plakaten, die im Land für die AfD werben sollen. Laut Recherchen von Standard, Spiegel und ZDF frontal besteht nun aber der Verdacht, bei der Zuwendung könnte nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Demnach vermuten österreichische Ermittler, Dingler könnte lediglich als Strohmann gedient haben. Den Berichten zufolge besteht der Verdacht, der aus Duisburg stammende Milliardär Henning Conle habe Dingler zuvor eine hohe Summe überlassen. Der Österreicher habe das Geld also lediglich weitergeleitet.
Die möglichen Konsequenzen: Laut Parteiengesetz sind Spenden, „bei denen es sich erkennbar um die Weiterleitung einer Spende eines nicht genannten Dritten handelt“, verboten. Bewahrheitet sich der Verdacht, droht der AfD eine hohe Strafe – dem Parteiengesetz zufolge in dreifacher Höhe des rechtswidrig erlangten Betrages. Das wären in diesem Fall etwa sieben Millionen Euro.
Wie reagiert die AfD? Schatzmeister Carsten Hütter teilte gestern mit, Herr Dingler habe gegenüber der Partei mehrfach versichert, „dass die Sachspende aus seinem privaten Vermögen getätigt wurde“. Die AfD stehe in ständigem Austausch mit der Bundestagsverwaltung, er biete „eventuell ermittelnden Behörden“ Transparenz und Mitarbeit an, teilte Hütter mit.
Unterstützung für die Grünen. Über zwölf Millionen Euro Spenden sind in 100 000 Einzelspenden der Partei in den vergangenen drei Monaten zugegangen, zudem wollten über 42 000 Menschen eintreten. Das teilte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Pegah Edalatian, gestern mit. Insgesamt sind nun rund 16 800 Menschen Mitglied der Grünen, so viele wie nie zuvor.
Rückenwind auf den letzten Metern. „Angesichts der aktuell unsicheren Zeiten wollen sich viele demokratisch engagieren und bekennen Farbe zu einer Partei, die an den Lösungen von morgen arbeitet“, teilte Edalatian mit. Die Mitgliedschaften und Spenden gäben der Partei starken Rückenwind für die letzten Tage vor der Bundestagswahl.
Unter eins
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert beim Gedenken an den Anschlag in Hanau ein pluraleres Deutschland
Zu guter Letzt
Für den überraschendsten Moment beim gestrigen TV-Duell zwischen Scholz und Merz sorgte der Kanzlerkandidat der Union. Es ging gerade um das Einkaufen im Supermarkt – beide Politiker waren zuletzt im Dezember einkaufen, bevor der Wahlkampf richtig losging – als Moderatorin und Bild-Chefin Marion Horn nach der bevorzugten Zahlweise fragte.
Scholz zahle zur Hälfte bar, zur Hälfte mit Karte. Merz hingegen sorgte für erstaunte „Uuuh“-Rufe bei den anwesenden Journalisten, die das Duell in einem Nebenraum verfolgten. Darunter befanden sich zahlreiche Auslandskorrespondenten. „Ich bezahle mit meinem Handy“, sagte er. Auch sonst war das Duell – neben den üblichen inhaltlichen Fragen – persönlicher als die anderen Formate. Emotional wurde es etwa, als Merz über seine Familie sprach: Der frühe Tod von zweien seiner drei Geschwister habe „tiefe Spuren“ hinterlassen.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfuhren auch, dass Hobbypilot Merz den Bundeskanzler in seinem Privatflugzeug mitnehmen würde. Und der würde auch mitfliegen: „Ich nehme an, er hat den Pilotenschein zu Recht“, sagte Scholz. Dafür würde Merz mit Scholz rudern gehen. „Da ich ganz gut schwimmen kann, auch ohne Schwimmweste“, witzelte Merz. Man müsse einander aber schon vertrauen im Boot, sagte Scholz, und er sei in der Regel Schlagmann, wenn er zu zweit rudere. Ob der Kanzler auch nach Sonntag weiter den Takt angeben wird, ist angesichts der Umfragewerte eher fraglich.
Grazie mille! Dem Team in Berlin und Hannover, den Kolleginnen in Australien.