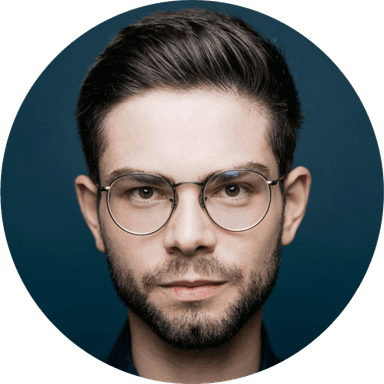Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerben
Die doppelten Sondierungen
Dienstag, 4. März 2025Guten Morgen. Wäre heute nicht Faschingsdienstag, die gemeinsame Botschaft von Union und SPD wäre viel schwerer zu vermitteln: Sie arbeiten, wenn andere feiern. Was am Freitag in Washington passiert ist, hat Schockwellen bis in die Parteizentralen gesendet. Die Zeit drängt.
Vor allem, wenn man noch die Mehrheitsverhältnisse des alten Bundestags nutzen will, um ein oder mehrere Sondervermögen zu beschließen. Bis zur Konstituierung des neuen Parlaments, spätestens am 25. März, müsste ein solcher Beschluss durch Bundestag und Bundesrat.
Im Gespräch war deshalb eine Sondersitzung des Bundestags vor dem 14. März, der Bundesrat tagt turnusgemäß am 21. März. Die SPD-Sondierer haben alle Termine am Aschermittwoch abgesagt und erhöhen den Druck auf die Union, dies ebenfalls zu tun.
Für Friedrich Merz kein großes Problem; es ist ein Test für Markus Söder, dessen CSU den Aschermittwoch als Politikevent erfunden hat. Willkommen am Platz der Republik.
ANZEIGE
Was wichtig wird
Um kurz vor 23 Uhr war es Markus Söder, der als Erster aus dem Besprechungsraum im Jakob-Kaiser-Haus Richtung Fahrstuhl ging. Gut sieben Stunden Gespräch lagen da hinter den Verhandlerinnen und Verhandlern. Söder wählte den direkten Weg, fuhr mit dem Aufzug in die Tiefgarage. Hubertus Heil, Anke Rehlinger und Manuela Schwesig mogelten sich nach Aufzugfahrt ins Erdgeschoss an den wartenden Journalisten vorbei. Mehr als „Gute Nacht“ war ihnen aber nicht zu entlocken. Das zeigt, was auf dem Spiel steht: Nichts soll nach außen dringen. Außerdem geht es heute um 8 Uhr ohnehin weiter mit Vorgesprächen, danach wird weiter sondiert.
Was zuvor geschah: Das Papier der vier Ökonomen Clemens Fuest, Michael Hüther, Moritz Schularick und Jens Südekum kursierte kurz vor Beginn der zweiten Sondierungsrunde im Regierungsviertel – und lag als Tischvorlage bei den Sondierern. Darin enthalten: ein Plan für zwei Sondervermögen in Höhe von insgesamt bis zu 900 Milliarden, die an der Schuldenbremse vorbei geschaffen werden könnten. Die Ökonomen sollen sich demnach am Donnerstag getroffen haben, um auf Initiative des saarländischen Finanzministers Jakob von Weizsäcker (SPD) die „anstehenden finanzpolitischen Handlungsoptionen“ für die Sondierungen auszuloten.
800 bis 900 Milliarden: In dem Dokument führen die Ökonomen in zwölf Punkten aus, wie der alte Bundestag noch vor Beginn der neuen Legislatur das „SV Bundeswehr“ aufstocken und ein weiteres „SV Infrastruktur“ danebenstellen soll. Beide Sondervermögen sollen demnach „sehr groß dimensioniert“ sein, vor allem als „Signal an Putin, dass Deutschland es ernst meint“. Für die Bundeswehr biete sich eine Größenordnung von 400 Milliarden Euro an, für die Infrastruktur mindestens derselbe Betrag, aber eher 400 bis 500 Milliarden Euro. Das sei abhängig von den einzubeziehenden Infrastrukturbereichen, schreiben die Ökonomen.
Belastbares Commitment: Eine Reform der Schuldenbremse im alten Bundestag sei illusorisch – aber im neuen Bundestag keinesfalls vom Tisch. Vielmehr müsse in den Koalitionsgesprächen ein „belastbares Commitment stehen, dass eine Reform der SB im Laufe der Legislatur kommt“. Hierfür sei auch eine Verständigung mit den Linken notwendig. Die Sondervermögen würden die Koalition unmittelbar handlungsfähig machen, heißt es. Sollte eine Reform der Schuldenbremse dann zeitnah gelingen, könne es dazu führen, dass sie nicht vollständig abgeschöpft werden müssen: Deren Höhe sei deshalb als „bis zu“-Klausel zu verstehen. Das gelte auch mit Blick auf einen möglichen europäischen Verteidigungsfonds.
Vorsicht an der Bahnsteigkante: Ein zentrales Problem dieser Lösung seien die Substitutionseffekte, von den Ökonomen auch als „Verschiebebahnhof“ bezeichnet. Heißt: Sobald ein „SV Infrastruktur“ komme, würden Bund, Länder und Kommunen in ihren Kernhaushalten die Investitionen herunterfahren – und sie für soziale Zwecke wie die Rente umwidmen. Zu lösen sei das einerseits durch ein politisches Commitment, genau das eben nicht zu tun. Und durch Anreize bei der Haushaltsführung.
Moderne Militärtechnik: Beim Sondervermögen für die Bundeswehr soll hingegen darauf geachtet werden, kein „Rheinmetall-Paket“ mit einem Schwerpunkt auf alter Technologie zu produzieren. So sollen etwa keine Panzer gekauft werden, die von günstigen Drohnen zerstört werden können. Vielmehr sollte den Ökonomen zufolge „modernste Militärtechnik“ angeschafft werden, etwa im Bereich Cybersecurity. Insgesamt gelte, dass 100 Milliarden zusätzliche Militärausgaben das Bruttoinlandsprodukt um bis zu 150 Milliarden Euro erhöhen können.
Die SPD will sich von außen begutachten lassen: Eine Kommission, die auch mit parteiexternen Fachleuten besetzt wäre, soll das schlechte Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl analysieren. Zudem soll sie daraus Schritte ableiten, wie die SPD wieder „als Volkspartei der linken Mitte wieder mehrheitsfähig wird“. Das geht aus einem Beschluss hervor, den der Parteivorstand am Montag einstimmig annahm. Das Papier liegt Elena Müller vor.
Neuer Parteivorstand? Die von Partei- und Fraktionschef Lars Klingbeil angekündigte „personelle, organisatorische und programmatische Erneuerung“ hat somit einen Plan. Das von Generalsekretär Matthias Miersch erarbeitete Konzept sieht zudem vor, den Bundesparteitag vorzuziehen. Möglichst soll dieser noch vor der Sommerpause stattfinden. Dort soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Aus der Partei werden immer wieder Stimmen laut, die eine Erneuerung der Parteispitze verlangen.
Grundsätzliches definieren: Nach dem Parteitag soll zudem die Grundwertekommission gemeinsam mit dem Vorstand damit beginnen, ein Konzept für ein neues Programm zu arbeiten. In zwei Jahren soll ein Parteitag ein neues Programm verabschieden. Ob es sich dabei aber um ein neues Grundsatzprogramm handeln soll, geht aus dem Beschluss nicht hervor. Das letzte Grundsatzprogramm der SPD stammt aus dem Jahr 2007. Abgeordnete der Partei forderten bereits in der vergangenen Woche ein neues Programm.
Communication is key: Drittens soll die Kommunikation innerhalb und aus der Partei heraus verbessert werden. Dafür sollen eigene Begriffe geprägt und die Politik der Partei „auch emotional positiv“ besetzt werden. „Die SPD soll wieder in der Lage sein, ihre Politik so zu kommunizieren, dass sie als Erfolg wahrgenommen wird“, heißt es in dem Beschluss. Außerdem soll die Parteiorganisation digitaler werden.
152 Abgeordnete der AfD werden künftig im Bundestag sitzen. Die Fraktion wird also deutlich größer sein als bisher. Entsprechend selbstbewusst werden ihre Mitglieder auftreten. Für die anderen Parteien stellt sich daher die Frage, wie sie damit umgehen sollen. Tim Frehler berichtet.
Bekommt die AfD einen Vizepräsidenten? Danach sieht es nicht aus. Friedrich Merz sagte im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, er werde der Unionsfraktion nicht empfehlen, Politiker der AfD in ein Staatsamt zu wählen. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte in der vergangenen Woche, die Abgeordneten der AfD könnten sich zwar zur Wahl stellen: Jede und jeder Abgeordnete habe dann aber die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Christian Görke, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken, sagte dem Tagesspiegel, seine Fraktion werde keinen Politiker der AfD zum Vizepräsidenten wählen. Es wird also aller Voraussicht nach dabei bleiben, dass die AfD diesen Posten nicht bekommt.
Zur Kasse, bitte: Aus der Unionsfraktion gibt es nun erste Gedankenspiele, um auf die Stimmung im Plenarsaal einzuwirken. In der Rheinischen Post schlug Patrick Schnieder, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, vor: Abgeordnete sollen in Zukunft bei drei Ordnungsrufen innerhalb von drei Sitzungswochen zwingend ein Ordnungsgeld in Höhe von 2000, im Wiederholungsfall 4000 Euro, bezahlen müssen. Bislang trennt die Geschäftsordnung des Bundestages Ordnungsrufe und Ordnungsgelder. Letztere können verhängt werden, ohne dass ein Ordnungsruf ergangen ist. Ihre Höhe liegt im Moment bei 1000 und im Wiederholungsfall bei 2000 Euro.
Grüne dabei: Die Grünen sind „nach wie vor offen“ für die Erhöhung und die schärfere Anwendung von Ordnungsgeldern, sagte deren Erste Parlamentarische Geschäftsführerin, Irene Mihalic, SZ Dossier. Größere Sorge mache ihnen allerdings das „gestiegene Extremismus-Potential durch deutlich mehr Abgeordnete und Mitarbeitende einer aus unserer Sicht verfassungsfeindlichen Fraktion wie der AfD.“
Nächster Anlauf: Mihalic drängt daher darauf, das Bundestagspolizeigesetz in der neuen Wahlperiode schnell zu beschließen. Dadurch „würde die Bundestagspolizei unter anderem dazu in die Lage versetzt, bei Extremismusverdacht direkt Anfragen an das Bundesamt für Verfassungsschutz zu stellen.“ Auch die Union will „endlich“ ein Bundestagspolizeigesetz, wie CDU-Politiker Schnieder der Rheinischen Post sagte. Ein von SPD und Grünen im vergangenen Dezember eingebrachter Gesetzentwurf versandete allerdings: Damals sagte der zuständige Berichterstatter, Michael Breilmann, meinem Kollegen Robert Roßmann von der SZ noch, die Union stehe für Schnellschüsse nicht zur Verfügung.
Über 200 Erstunterzeichnende aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung fordern eine umfangreiche Staats- und Verwaltungsreform, um den Staat „leistungsfähig, innovativ und menschenzentriert“ zu machen. „Ohne eine Reform sind zentrale Zukunftsaufgaben – ob eine neue Industriepolitik, ein effektiver Klimaschutz, eine schnelle Digitalisierung, eine zeitgemäße Bildung oder ein wirkungsvolles Sozialsystem – nicht lösbar“, heißt es in einem Aufruf, der heute veröffentlicht wird. Der Status quo sei keine Option.
Prominente Liste: Zu den Erstunterzeichnenden gehören unter anderem die Chefs der Staatskanzlei Fedor Ruhose aus Rheinland-Pfalz, Nathanael Liminski aus Nordrhein-Westfalen sowie Dirk Schrödter aus Schleswig-Holstein. Die ehemaligen Bundesminister Thomas de Maizière und Peer Steinbrück sowie der langjährige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle haben ebenfalls unterzeichnet. Hinzu kommen Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft wie Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands.
Grundlegende Reformen: Um den Herausforderungen gerecht zu werden, müsse der Staat sich „grundlegend“ reformieren. „Von der Gesetzgebung über die Verwaltungsleistungen bis hin zur föderalen Aufgabenverteilung“, heißt es. „Diese Reform ist nicht nur ein Regierungsprojekt – sie muss eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, getragen von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.“ In der Sache gebe es eine „hohe Übereinstimmung“ zwischen den demokratischen Parteien und einen „ungewöhnlichen Konsens“ nahezu aller Fachleute.
Klare Steuerung: „Wir wollen diese Kräfte bündeln und einen überparteilichen Reformprozess vorantreiben.“ Daher müsse eine „umfassende Staats- und Verwaltungsreform“ ein „zentrales Reformprojekt der nächsten Bundesregierung werden – mit höchster Priorität im Koalitionsvertrag“. Sie dürfe nicht zwischen Ressortzuständigkeiten versanden, sondern brauche eine klare politische Steuerung: „getrieben vom künftigen Bundeskanzler und umgesetzt von Personen mit starkem politischen Mandat“.
Konkreter werden sieben Bereiche ausgeführt. So sollen etwa für den „Team Staat“ die „besten Köpfe“ gewonnen werden. Gesetze sollen hingegen „von Beginn an praxisnah und datenbasiert“ entwickelt sowie „an Ziele gekoppelt“ und „gemeinsam mit Kommunen und betroffenen Gruppen“ getestet werden. Zudem müsse verändert werden, wie öffentliche Gelder eingesetzt werden. Es brauche eine „neue Steuerungslogik“, die auf Wirkung setze: Haushaltsmittel sollen an Ziele gebunden werden. Die Vorschläge bleiben oberflächlich, sollen aber in den kommenden Wochen ausgearbeitet werden.
ANZEIGE
Tiefgang
Nach dem Eklat im Weißen Haus ist der zuvor erwartete Pfad zu einem Waffenstillstand in der Ukraine und damit zu einem – unsicheren – Frieden verschüttet.
Drei Möglichkeiten für die weitere Entwicklung:
Szenario 1: Die USA kappen die Unterstützung, der Krieg geht weiter. Die Abhängigkeit der ukrainischen Verteidigung von US-Material und -Fähigkeiten ist enorm. Da die Front sich seit Sommer 2022 tendenziell zuungunsten der Ukraine verschoben hat, lässt sich sagen: Mit US-Unterstützung, dem „entscheidenden Rettungsanker“ für die Ukraine, herrschte eine ungefähre Kräftegleichheit. Ohne sie wird Russland voraussichtlich schneller vordringen können.
Wenn die ukrainische Verteidigung zusammenbricht, wird sich die Front rasch weiter ins Kernland des angegriffenen Landes verschieben. Putins ursprüngliches Kriegsziel Kyiv rückt dann wieder in Reichweite.
Der Knackpunkt: Waffen sind wichtiger als Geld. Ein Großteil der US-Milliardenhilfen wird keineswegs in die Ukraine überwiesen. Für das Geld wird in den USA Material beschafft, das das Pentagon dann ins Kriegsgebiet schickt.
Die Einkaufsliste ist lang. Unter anderem stehen darauf die Panzerabwehrrakete Javelin, die Luftabwehrsysteme Patriot, Hawk und Nasams, die Flugabwehrraketen Stinger, Aim und Avenger, das Antidrohnensystem Vampire, zehn verschiedene Drohnenmodelle, Helikopter, Anti-Schiffs-Raketen zur Küstenabwehr, Raketenwerfer, Radarstationen, Haubitzen, Artilleriemunition, Granaten, Panzer vom Typ Abrams, Bradley und T-72B, Minensuchausrüstung, und vieles mehr.
1a: Trump mobilisiert keine zusätzliche Hilfe, lässt aber weiter die bereits zugesagte Ausrüstung liefern. In diesem Fall schickt Amerika noch für Jahre Militärgerät – 2025 sogar mehr als je zuvor. Denn die Haushaltsposten aus der Biden-Zeit sind verplant, die physischen Geräte aber noch längst nicht alle verschifft. Das Pentagon wartet in der Regel, bis Ersatzlieferungen von den Rüstungsherstellern absehbar sind, bevor es die Flüge mit Material losschickt. Die Bearbeitung der Aufträge dauert jedoch selbst in den USA viele Monate.
In diesem Fall könnte die Ukraine noch monatelang durchhalten, weil der Strom an Munition, Raketenwerfer, Drohnen und so weiter vorerst nicht abreißt. Dieses Szenario lässt auch die Möglichkeit offen, dass Europa mit Hilfsgeldern in den USA Waffen für die Ukraine bestellt. Auf jeden Fall bringt es Zeit.
1b: Trump stoppt diese Lieferungen. Die Wirkung wäre katastrophal, und das sofort. Es kommt im Krieg auf die schiere Menge Material an, das verbraucht und ersetzt werden kann. Ein großer Teil des bereits bezahlten Geräts gehört zwar rechtlich der Ukraine, aber Trump wird das kaum respektieren, wenn er die Ausfuhr verbietet.
Wenn Trump auch die Nutzung von intelligenten Waffen behindert, die schon auf dem Schlachtfeld im Einsatz sind – zum Beispiel durch Softwaresperren oder die Verweigerung von Ersatzteilen – ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Front kollabiert.
Können die Europäer einspringen? Europa kann zwar mehr Geld aufbringen. Doch mit Geld allein lässt sich nicht so richtig etwas anfangen. Die Ukraine braucht in erster Linie Waffen und Aufklärung. Das Geld ist Mittel zum Zweck des Waffenkaufs, und in den USA erfüllt es diesen Zweck, weil das Pentagon so große Vorräte hat und die US-Waffenindustrie viel liefern kann.
Europas Kapazitäten für eine eigene Herstellung von Waffen sind dagegen bereits am Limit. So haben die Niederländer bereits ihre F-16-Jets in die Ukraine verschifft, und für Panzer musste das Kanzleramt einen Ringtausch organisieren. Die europäische Rüstungsbranche arbeitet zu langsam, um sofort viel liefern zu können.
Folgen für Deutschlands Sicherheit: Nach einem hypothetischen Fall der Ukraine würde Putin dort vermutlich einen Moskau-treuen Staatschef installieren. Das russische Einflussgebiet schöbe sich dann auch von Süden an Polen heran. Lwiw ist nur neun Fahrstunden von Berlin entfernt. Im Osten grenzt Polen bereits an den russischen Vasallenstaat Belarus.
Russlands Rüstungsmaschinerie fährt jetzt erst richtig hoch, die Herstellung von Munition soll in diesem Jahr noch einmal um ein Drittel steigen. Europäische Staatshaushalte würden enorm belastet durch die Kosten, das siegreiche Russland ohne amerikanische Rückendeckung abzuschrecken.
Szenario 2: Bauernopfer Selenskij. Um Trump zu besänftigen, könnte die Ukraine neues Personal ins Rennen schicken. Der Präsident würde zurücktreten und jemand anderes müsste einen neuen Anlauf in Washington machen – Schmeicheleien und Demutsgesten inklusive.
Aber will Trump überhaupt besänftigt werden? Seine Parteinahme für Putin ist beispiellos. Es bleibt der Verdacht, dass ihm und J. D. Vance die diplomatische Kernschmelze im Weißen Haus nur allzu recht war, um Punkte für Putin zu sammeln. Dafür spricht die ungewöhnliche Vorgehensweise, vor laufenden Kameras so tief in inhaltliche Fragen einzusteigen, ohne erst hinter verschlossenen Türen verhandelt zu haben. Unter anderem das Magazin Economist sprach sogar von einer Falle, in die Vance Selenskij gelockt habe.
Szenario 3: Rückkehr zu Gesprächen mit den USA unter Selenskij. Das würde eine Fortsetzung der US-Unterstützung bis zum Waffenstillstand erlauben. Dieses Szenario hat das geringste kurzfristige Katastrophenpotenzial.
Falls Selenskij sich entschuldigt, wie von US-Außenminister Rubio gefordert, und sich nochmals demütig bei den USA bedankt, wie von Vance gefordert, gebe es keinen vernünftig erscheinenden Grund, warum Trump den von ihm selbst durchgedrückten Rohstoffdeal ablehnen könnte. Die US-Unterstützung könnte vorerst unverändert weiterlaufen.
Diese Lösung wäre unbefriedigend, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt besser als ein Bruch der USA mit der Ukraine. Finn Mayer-Kuckuk
Dieser Text erschien zuerst am Sonntagabend in unserem Dossier Geoökonomie, das Sie zwei Wochen lang kostenlos testen können.
Fast übersehen
Sichtungen häufen sich: Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen große Drohnen über dem Norden der Republik gesichtet. Dort kreisten über Liegenschaften der Bundeswehr und kritischen Infrastrukturen. Doch so viele wie Ende voriger Woche wurden bislang offenbar noch nicht gesichtet, schreiben Florian Flade, Jörg Schmitt und Sina-Maria Schweikle in der SZ.
Sie kommen übers Meer. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Drohnen könnten von der Nordsee kommend in den deutschen Luftraum eingedrungen sein. Wer die verdächtigen Drohnenflüge über Militär- und Industrieanlagen in den vergangenen Monaten zu verantworten hat, ist unklar. Natürlich besteht der Verdacht, dass Russland dahinterstecken könnte.
Abwehr gelingt bislang nicht. Westliche Dienste gehen davon aus, dass die Überflüge Teil der hybriden Kriegsführung sind. In der Bundeswehr gibt es Stimmen, die davon ausgehen, dass Russland die Drohnen nutzt, um etwa hochpräzise Luftaufnahmen von Militärstützpunkten, Industrieanlagen und Energieversorgungseinrichtungen zu machen. Versuche, die Drohne mit Störsendern und anderen Vorrichtungen vom Kurs abzubringen oder zur Landung zu zwingen, blieben erfolglos.
Wo ist Wagenknecht? Bei der Bundestagswahl hat das BSW den Einzug in das Parlament verpasst, ein erstes Comeback über die Hansestadt Hamburg ist ausgeblieben. Parteichefin Sahra Wagenknecht hatte sich bereits am Wahlabend vorvergangene Woche rar gemacht. Nun hat sie auch ihre Teilnahme am Politischen Aschermittwoch in Niederbayern abgesagt. Sie wäre gern gekommen, heißt es in einer Mitteilung, die ihre Partei gestern verschickte. Gründe für die Absage finden sich darin aber nicht. Für die Parteichefin springt der Europaabgeordnete Fabio de Masi ein.
Verstummt ist Wagenknecht aber nicht. Auf X teilte sie gestern einen Blogbeitrag des Ökonomen und ehemaligen Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium (unter Oskar Lafontaine), Heiner Flassbeck. Darin sprach der sich für eine Koalition von Union und AfD aus. Wagenknecht schrieb dazu, es sei ein „großes Versagen der CDU, die AfD nicht früher eingebunden und entzaubert zu haben“. Die Brandmauer ebne der AfD den Weg ins Kanzleramt. In einem weiteren Post polterte Wagenknecht gegen ein mögliches weiteres Sondervermögen für Verteidigung. Zu ihrer Partei und dazu, was aus dem BSW werden soll, äußerte sie sich nicht.
Unter eins
Der britische Premierminister Keir Starmer über die neue „Koalition der Willigen“
Zu guter Letzt
Als Hubertus Heil um 17:30 Uhr seinen Weg zum Raucherbereich des Jakob-Kaiser-Hauses antritt, hält der Aufzug zweimal falsch. Der Arbeitsminister, als Sozi erkennbar an seiner roten Krawatte, will in den ersten Stock, aber erst beim dritten Anlauf hält der Aufzug an der gewünschten Stelle. Unten im Erdgeschoss stehen die Kameras der Hauptstadtpresse, direkt vor den Aufzügen sind Mikrofone aufgebaut.
Die Sondierer, die vorbei wollen, müssen hier jedes Mal das Kunststück vollbringen, sich möglichst freundlich und nichtssagend an der fragenden Horde vorbei in den Lift zu mogeln. Nicht jeder hatte dabei gestern die Zeit auf seiner Seite.
„Der Aufzug kommt sonst immer schneller“, sagte etwa CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der einen schwarzen Aktenordner dabeihat. Sein Smalltalk-Versuch: Er habe am Wochenende den Talkshow-Auftritt einer anwesenden Journalistin gesehen, erzählt er. Die wiederum stellt eine inhaltliche Frage: ohne Erfolg. Dann ertönt der einprägsame Gong des Aufzugs: Linnemann steigt ein, die Türen schließen.