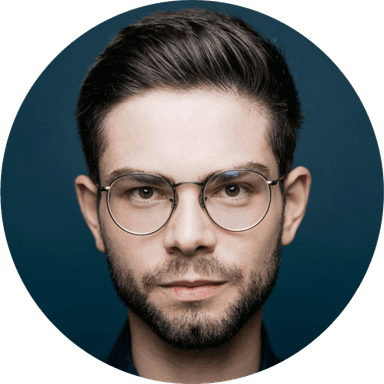Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerben
Neue Milliarden, alte Bedrohungen
Mittwoch, 19. März 2025Schnelldurchlauf:
Grünes Licht für das schwarz-rot-grüne Milliardenpaket +++ Baerbock bekommt Top-Posten bei den Vereinten Nationen +++ Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geht weiter +++ Digitaler Staat: 25 Jahre des Scheiterns +++ Tiefgang: „Klimaneutralität bis 2045“ ist weder Staatsziel noch Grund zur Klage
Guten Morgen. Rund zwei Stunden nach dem Telefonat von Donald Trump und Wladimir Putin heulten gestern Abend in Kyiv die Sirenen. Damit machte Moskau unmissverständlich klar: Es wird vorerst keine Waffenruhe geben, der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht weiter.
Am Abend reagierten Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verhalten auf die ersten Details aus dem Gespräch (dazu unten mehr). „Wir sind uns völlig einig: Das Ziel aller Bemühungen muss ein gerechter und dauerhafter Frieden für die Ukraine sein“, sagte Scholz nach einem Treffen im Kanzleramt. Man habe eben gemeinsam mit Wolodimir Selenskij Kontakt gehabt und auch mit „den USA“ gesprochen.
Es gibt viel zu tun: Macron traf sich noch mit Merz zum Abendessen. Der wird über die frisch beschlossenen Milliardeninvestitionen in die deutsche Verteidigungsfähigkeit berichtet haben. Sie werden aber nur der Anfang sein, hin zu einer gemeinsamen europäischen Verteidigung und strategischen Souveränität des Kontinents.
Willkommen am Platz der Republik.
Was wichtig wird
Deutschland ist also wieder da, so sahen es einige Beobachter aus dem Ausland. Und so möchten die künftigen Koalitionäre ihre Schuldenbeschlüsse gern interpretiert wissen. In der Tat war der 18. März 2025 ein historischer Tag, obwohl die Debatte im Bundestag größtenteils den Linien der ersten Lesung am vergangenen Donnerstag folgte. Mit einem Unterschied: Am Ende standen 512 Ja- gegen 207 Nein-Stimmen – notwendig für die Grundgesetzänderungen zur Lockerung der Schuldenbremse und Schaffung des Sondervermögens war eine absolute Zweidrittelmehrheit von mindestens 489 Stimmen.
Die Schlacht war geschlagen, der Kompromiss gefunden. Und damit kam es gestern eigentlich nur noch auf das Endergebnis an. Merz, Klingbeil und Haßelmann wiederholten ihre Argumente, letztere kritisierte Merz trotz des Kompromisses erneut: Dass er die Notwendigkeit erst jetzt erkenne, sei „schon verdammt bitter“. Der Kanzler in spe wiederum kündigte einen Paradigmenwechsel in der Verteidigungspolitik und „nicht weniger als einen Schritt zu einer neuen Europäischen Verteidigungsgemeinschaft“ an. Verteidigungsminister Pistorius fasste das Milliardenpaket pointiert zusammen: „Bedrohungslage steht vor Kassenlage.“
Dann kam es zur Abstimmung: Es gab keine Überraschung. Wie aus den Abstimmungsdaten des Bundestags hervorgeht, stimmten nur drei Abgeordnete der schwarz-rot-grünen Zweckgemeinschaft mit Nein: Mario Czaja (CDU), Jan Dieren (SPD) und Canan Bayram (Grüne). Bei CDU, SPD und Grünen gab es null Enthaltungen, sieben Abgeordnete blieben der Abstimmung fern. Große Geschlossenheit also, vor allem bei der Union – aber mit Bauchschmerzen: Einige MdBs gaben eine persönliche Erklärung ab, etwa Tilman Kuban, Gitta Connemann und Klaus-Peter Willsch.
Wie es weitergeht: Nun soll am Freitag noch der Bundesrat zustimmen. Auch die Länderkammer muss auf eine Zweidrittelmehrheit von 46 Stimmen kommen. Da Bayern zustimmen wird, sollte das kein Problem sein. Insgesamt dürften die Länder interessiert an einem Beschluss sein, da auch sie mehr finanziellen Spielraum bekommen.
Außenministerin Annalena Baerbock zieht es nach New York: Nach dem Ausscheiden aus dem Auswärtigen Amt wechselt die Grünen-Politikerin zu den Vereinten Nationen. Baerbock soll Präsidentin der UN-Generalversammlung werden, wie der SZ aus Regierungskreisen bestätigt wurde. Der entsprechende Kabinettsbeschluss ist im Umlaufverfahren bereits auf den Weg gebracht worden.
Berlin hat Posten sicher: Wie Daniel Brössler und Markus Balser berichten, gilt die Abstimmung in New York als Formalie, da Deutschland den auf ein Jahr terminierten Posten schon für sich gesichert hat. Der Vorsitz wird von der UN-Generalversammlung Anfang Juni gewählt, das Amt ist nicht zu verwechseln mit dem des UN-Generalsekretärs António Guterres. Eigentlich sollte der Posten von der Top-Diplomatin Helga Schmid besetzt werden, die nun zunächst eine herausgehobene Stellung bei der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) bekleiden soll.
Auftritt im September: Baerbock selbst hatte nach der Bundestagswahl angekündigt, sie strebe keine Führungsposition bei den Grünen mehr an. Daraufhin war im Regierungsviertel spekuliert worden, dass sie einen internationalen Posten anstrebt. Als Präsidentin wird Baerbock im September die 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen eröffnen. Mit Übernahme der neuen Aufgabe will sie ihr Bundestagsmandat niederlegen.
Gestern haben Donald Trump und Wladimir Putin rund zwei Stunden lang telefoniert. Das Ergebnis: eine Aussetzung der Angriffe auf Energieinfrastruktur für 30 Tage, die gleichzeitig der Beginn eines Friedensprozesses sein soll. Das teilte die US-Regierung mit. Trumps Plan, in dieser Woche eine vollständige 30-tägige Waffenruhe zu schmieden, ist damit vorerst gescheitert.
Details: Es soll laut einer Presseerklärung aus dem Weißen Haus auch Vorbereitungen für eine Feuerpause auf dem Schwarzen Meer geben. Darüber soll ab sofort im Nahen Osten verhandelt werden. Während die Ukraine zuvor auf den US-Vorschlag einer generellen Waffenruhe eingegangen war, stimmte Putin nicht zu. Es gebe noch eine Reihe offener Punkte, berichteten russische Nachrichtenagenturen: Putin fordert etwa einen vollständigen Stopp der Waffenhilfen für Kyiv, auch mit der Weitergabe von Geheimdienst-Informationen soll Schluss sein.
Deutschlands Reaktion: Die in Aussicht gestellte Waffenruhe für Angriffe auf Energieinfrastruktur könne ein „erster wichtiger Schritt auf dem Weg sein“, sagte Scholz gestern Abend. Das gelte auch für die Aufnahme technischer Verhandlungen für eine Waffenruhe auf See. „Der nächste Schritt muss ein vollständiger Waffenstillstand für die Ukraine sein und das möglichst schnell“, sagte Scholz. Derweil hat das Bundesfinanzministerium nach langem Streit seine Zustimmung zur Auszahlung eines drei Milliarden Euro schweren Hilfspakets zur militärischen Unterstützung der Ukraine erteilt: Grünes Licht im Haushaltsausschuss soll es Medienberichten zufolge am Freitag geben.
Back to business: Die Trump-Administration betonte in ihrer Erklärung die „Notwendigkeit verbesserter bilateraler Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland“. Konkreter hieß es, dass sich Trump und Putin einig gewesen seien, dass eine solche Verbesserung enorme Vorteile mit sich bringe. „Dazu gehören enorme Wirtschaftsgeschäfte und geopolitische Stabilität, wenn der Frieden erreicht ist“, hieß es in der US-Erklärung.
An der vorhandenen Zeit scheiterte der digitale Staat bisher nicht. „Seit 25 Jahren diskutieren wir über die immergleichen Themen“, sagte Florian Theißing. „Es wurde viel geredet und gemacht, aber wenig erreicht.“ Der Experte der Denkfabrik Agora Digitale Transformation hat gemeinsam mit dem Stein-Hardenberg-Institut versucht, die mehr als zwei Jahrzehnte laufenden Initiativen aufzuarbeiten, Lektionen daraus zu ziehen und in ein Papier zu gießen. Über das Ergebnis hat Matthias Punz vom Dossier Digitalwende gestern exklusiv berichtet.
Problem eins: die politische Opportunität. Mehrere Generationen von Politikerinnen und Politikern hätten Verwaltungsdigitalisierung auf öffentlichkeitswirksame „Schaufensterdigitalisierung“ reduziert, lautet das Fazit. Sprich: hier ein schicker Online-Service, da eine neue Homepage – während übergreifende Strukturen bis heute fehlen.
Problem zwei: der Föderalismus und das Ressortprinzip. Viele reden mit, wenige wollen kooperieren. Der digitalen Transformation fehle es an zentraler Steuerung. Bund und Länder (zer-)diskutierten in der Vergangenheit viele Themen und Projekte. Manchmal so lange, bis die ursprüngliche Idee technisch veraltet war.
Problem drei: das fehlende Zielbild. Verwaltungsdigitalisierung und Staatsmodernisierung werden nicht zusammen gedacht, lautet die Kritik. Das zieht sich bis heute durch: Union und SPD verhandeln derzeit – wie bereits die Ampel-Verhandler – den digitalen und den modernen Staat getrennt voneinander (SZ Dossier berichtete). „Wenn wir Verwaltungsdigitalisierung und eine Staatsreform nicht zusammen denken, wird es nie ein richtiges Zielbild geben, weil das eine Thema das andere bedingt“, sagte Theißing.
Tiefgang
Klimaschutz ist auch nach der gestern vom Bundestag beschlossenen Reform des Grundgesetzes weiterhin kein Staatsziel. In der deutschen Verfassung steht nun in Artikel 143h, dass das Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro „für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045“ genutzt werden soll.
Mit der Formulierung geht der Gesetzgeber weiter den Weg, den das Bundesverfassungsgericht mit einem wegweisenden Urteil von 2021 bereits aufgezeigt hat. Auf das Datum hatten sich Bundestag und Bundesrat bereits im Klimaschutzgesetz Mitte 2024 geeinigt. In der EU gilt laut dem Green Deal das Jahr 2050 als Zielmarke für Klimaneutralität. Das bedeutet, dass Wirtschaft und Bevölkerung nicht mehr Treibhausgase ausstoßen dürfen, als wieder neutralisiert oder zum Beispiel unter der Erde verpresst werden können.
Das Ziel 2045 sei zu ehrgeizig, findet jedoch die Wirtschaft und fürchtet, dass Infrastrukturprojekte jetzt immer wieder dem Klimaschutz untergeordnet werden müssten und anderenfalls Klagen drohten.
Doch die zum Thema befragten Staatsrechtler scheinen sich einig zu sein: Bei der Formulierung handele es sich lediglich um eine neue „finanzverfassungrechtliche Vorschrift“; wie es Christian Calliess, Professor für Verfassungs- und Umweltrecht an der FU Berlin, im Handelsblatt nennt: „Die geplante Ergänzung unserer Verfassung führt nicht zu einem neuen Staatsziel Klimaschutz mit Verpflichtung auf Klimaneutralität bis 2045.“
Die Union, die mit der Aufnahme der Formulierung eine Bedingung der Grünen für deren Zustimmung zum Finanzpaket erfüllt hat, sah sich jedoch in den Tagen nach der Einigung dazu gedrängt, immer wieder auf genaue Formulierung und ihre Bedeutung hinzuweisen.
So schrieb Philipp Amthor, Mitglied des CDU-Bundesvorstands und Teil der Koalitionsverhandlungsgruppe, in einem Gastbeitrag für die Welt: „Durch eine Grundgesetzänderung soll am Dienstag eine Richtungsentscheidung für die Zukunft der Staatsfinanzen getroffen werden.“
Er beantwortet die rhetorische Frage „Verbindet sich mit diesem Kompromiss auch eine grundlegende Neubestimmung der Klimaneutralität im Grundgesetz?“ daraufhin gleich selbst: Dies sei „mitnichten“ so; geregelt werde keine neue Staatszielbestimmung, sondern lediglich eine Zweckbestimmung für den Staatshaushalt, so Amthor.
Groß ist wohl die Sorge, die Anhängerinnen und Anhänger der Konservativen könnten glauben, die Union habe für die Zustimmung zum Schuldendeal einen zu hohen Preis bezahlt. Und die Kernklientel aus Unternehmerinnen und Unternehmern hat Angst vor Klimaklagen.
Deshalb verneinte CDU-Chef Friedrich Merz beim Bild-Interview unter dem Titel „Klagt die Klima-Lobby unsere Wirtschaft kaputt?“ die Frage: „Die jetzt vorgesehene Verfassungsänderung macht den Weg frei für zusätzliche Investitionen in den Klimaschutz, aber keineswegs für neue Klagemöglichkeiten.“ Das Jahr 2045 stehe allein im Zusammenhang mit dem Verwendungsnachweis der zusätzlichen Investitionen aus dem Sondervermögen – nicht als neues Staatsziel im Grundgesetz, machte Merz deutlich.
Im Kontext der Entscheidung von gestern wurde auch auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021 verwiesen. Damals hatten die Richterinnen und Richter Artikel 20a GG („Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere…“) bereits den Umweltschutz als Aufgabe des Staates und Verantwortung gegenüber kommenden Generationen konkretisiert.
Der Rechtsexperte Helmut Philipp Aust, Professor für Öffentliches Recht an der Freien Universität Berlin, schrieb für den Verfassungsblog zum Urteil, dass das Gericht den Verfassungsauftrag zum Klimaschutz so verstehe, „dass er zwangsläufig zur Klimaneutralität führen muss“. Auf der Grundlage der naturwissenschaftlichen Studien, zitiert Aust Karlsruhe, sei ein anderer Schluss nicht möglich. Somit ist die Klimaneutralität selbst als Staatsziel nicht ein Druckmittel der Grünen, sondern letztlich nur die Konsequenz aus den Vorgaben des Verfassungsgerichts. Elena Müller
Fast übersehen
Internationaler Appell an Schwarz-Rot: Die schwarz-rote Arbeitsgruppe „Außen und Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte“ bekommt heute Post, berichtet Michael Bauchmüller in der SZ. Vier ehemalige Staats- und Regierungschefs haben einen offenen Brief verfasst. „Die Welt zählt auf Sie“, heißt es darin. Es geht um Deutschlands Rolle bei der internationalen Entwicklungsfinanzierung und damit um die Frage, ob sich die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen noch erreichen lassen.
Die Unterzeichnenden sind keine Unbekannten. Mary Robinson etwa, ehemalige Präsidentin Irlands und spätere UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Oder Helen Clark, bis 2008 Premierministerin Neuseelands und anschließend Chefin des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Die ehemalige norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg hat unterschrieben und auch Stefan Löfven, der bis 2021 Regierungschef in Schweden war. Mittlerweile ist er der Chef der europäischen Sozialdemokraten.
Führung bestellt: Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass Entwicklungsarbeit wirke, heißt es in dem offenen Brief. „Doch diese Erfolge sind in Gefahr“, warnen die Vier. „Jetzt ist es Zeit, Führung zu übernehmen“, mahnen sie. „Aus Berlin muss das klare Signal in die Welt gehen, dass Deutschland trotz des starken Gegenwinds weiter auf internationale Zusammenarbeit setzt – mit dem klaren Ziel, die Welt gerechter zu machen.“
Ermittlungen gegen MdB: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Linken-Abgeordnete Gökay Akbulut. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, führt die Behörde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegen Akbulut. Demnach soll sie auf der Zugfahrt eine Flasche in Richtung eines Mitreisenden geworfen haben.
Was zuvor geschah: Die Abgeordnete hatte Ende Januar auf Instagram geschrieben, sie sei in einem Zug beleidigt und angegriffen worden. Ihr sei von einem Mann eine Bierflasche gegen den Kopf geworfen worden, zudem sei sie rassistisch beleidigt und sexuell belästigt worden. Die Stuttgarter Zeitung berichtete, dass Akbulut Mitreisende beleidigt haben soll. Zwei Augenzeugen beschrieben, Akbulut habe eine Flasche in Richtung einer Gruppe Fußballfans geworfen. Daraufhin sei ein Gegenstand zurückgeworfen worden.
Aufhebung der Immunität? Die Staatsanwaltschaft hat zudem beim Bundestag einen Antrag zur Aufhebung der Immunität von Akbulut gestellt, um auch wegen des Verdachts der Beleidigung ermitteln zu können. Akbulut äußerte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht zu den Ermittlungen. Über den Antrag sei noch nicht entschieden worden.
Eier, wir brauchen Eier! Es ist eine gute Nachricht für Trump und die Konsumentinnen und Konsumenten in den Vereinigten Staaten, berichtet Finn Mayer-Kuckuk. Die Großhandelspreise für Eier in den USA sind im Wochenverlauf erstmals seit Ausbruch der Vogelgrippe gefallen. Der Grund für die Entspannung ist allerdings nicht die Wirtschaftspolitik des Präsidenten, sondern eine langsamere Verbreitung der Geflügelseuche. Tatsächlich zeigt das Eier-Beispiel, wie wichtig freier Handel für Versorgungssicherheit und Wohlstand ist.
Import als Lösung: Zwar sinken die Großhandelspreise, doch die Supermarktpreise für Eier bleiben in den USA auf absehbare Zeit hoch. Abhilfe will das Agrarministerium durch eine Steigerung des Eier-Imports schaffen. Wichtige Herkunftsländer sind die Türkei und Brasilien. Während Trump den freien Handel mit Füßen tritt, ist er also zugleich auf kostengünstige Lieferungen von Produkten angewiesen, die die USA derzeit nur zu hohen Kosten selbst herstellen können. Stark gestiegene Lebensmittelkosten sind ein Treiber der Inflation.
Ironien der Handelspolitik: Die US-Regierung hat auch Dänemark um Eier-Lieferungen gebeten. Jenes Land also, dem Trump in einer harten, dreisten Aktion Grönland wegnehmen will. Dänemark antwortete, es habe derzeit keine Eier übrig. Aus Sicht der EU könnte der US-Bedarf an ausländischen Agrarprodukten zum Teil der Verhandlungsstrategie um Zölle werden. Dabei will Trump eigentlich, dass die EU weniger Waren in die USA liefert. Mehr dazu haben heute die Kolleginnen und Kollegen vom Dossier Geoökonomie.
Unter eins
Der Soziologe Armin Nassehi argumentiert in einem SZ-Gastbeitrag, dass der Schuldenbeschluss zu einem Konjunkturprogramm für die AfD werden könnte
Zu guter Letzt
Heute und morgen werden wieder einmal die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bestreikt. Heißt also: Die U-Bahnen, Straßenbahnen und (so gut wie alle) Busse in der Hauptstadt stehen 48 Stunden lang still. Eine Übersicht über die Alternativen und Ausnahmen hat der Tagesspiegel hier.
Hintergrund des Streiks sind die laufenden Verhandlungen zwischen BVG und Verdi über einen neuen Tarifvertrag. Vergangene Woche hatte die BVG der Gewerkschaft ein neues Angebot unterbreitet. Die Kerndaten: rund 13,6 Prozent mehr Gehalt bei einer auf 24 Monate verkürzten Laufzeit. Verdi nannte das Angebot „völlig unzureichend“ und fordert weiterhin 750 Euro mehr pro Monat für alle Beschäftigten, höhere Schichtzulagen und eine Laufzeit von nur zwölf Monaten.
Berlinerinnen und Berliner werden sich daran erinnern: Während der aktuellen Verhandlungen gab es bereits zwei Warnstreiks. Doch damit nicht genug. Falls es bei einer Gesprächsrunde am Freitag zu keiner Einigung kommt, hat die Gewerkschaft bereits eine Urabstimmung über unbefristete Streiks in Aussicht gestellt. Es könnte sich also lohnen, das alte Fahrrad aus dem Keller zu holen.