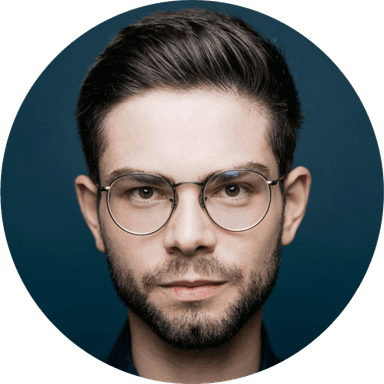Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerbenGuten Morgen. Nicht nur die Verhandlerinnen und Verhandler von Union und SPD haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt, die sie wahrscheinlich nicht einhalten können: Bis Ostern wollen die USA laut Bloomberg einen Waffenstillstand in der Ukraine erreichen. Dafür führen US-Unterhändler in Saudi-Arabien in den kommenden Tagen getrennte Gespräche mit Delegationen aus Kyiv und Moskau.
Gestern hat bereits ein Treffen zwischen der ukrainischen und US-amerikanischen Delegation stattgefunden, heute ist eines mit russischen Regierungsvertretern geplant. Das Ziel Donald Trumps ist eine Feuerpause an allen Fronten, die den Weg für einen dauerhaften Frieden ebnen soll.
Russische Narrative übernahm derweil sein Sondergesandter für den Nahen Osten, der zuvor Wladimir Putin in Russland getroffen hatte: Steve Witkoff erklärte in einem TV-Interview, dass Russland fünf Regionen in der Ukraine „zurückerobert“ habe, die „russischsprachig“ seien. Ob ein Waffenstillstand unter solchen Vorzeichen gelingt, ist mehr als fraglich.
Zurück nach Berlin: Heute blicken wir unter anderem auf die Koalitionsverhandlungen, die Konstituierung des Bundestages und die Frauen in der Union. Willkommen am Platz der Republik.
Was wichtig wird
Spätestens um 17 Uhr müssen die 17 schwarz-roten Arbeitsgruppen ihre Papiere abgegeben haben. Wie aus der Handreichung zu den Koalitionsverhandlungen hervorgeht, sollen die Abschlussdokumente der Arbeitsgruppen „möglichst kurz und präzise“ sein. Strittige Punkte sollen „im Ausnahmefall“ in rot (SPD) und blau (Union) markiert werden. Geplant ist dann eine dreitägige Redaktionsphase bis Donnerstag, in der die Ergebnisse und Unterschiede zusammengefasst werden. Doch es hakt in gleich mehreren Arbeitsgruppen.
Die größten Streitpunkte: Steuern, Sozialpolitik, illegale Migration. Bei mehreren Schlüsselthemen sollen sich Union und SPD in einem Grundsatzstreit verhakt haben, berichtet die SZ, gerade in Finanzfragen. Es sei in einigen Bereichen nicht gelungen, Kompromisslinien aufzuzeigen. Ein Beispiel: Die Union will die Schuldenpakete durch Steuersenkungen für alle und weitere Verbesserungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergänzen, die SPD hält eine Entlastung auch von Top-Verdienern für ungerecht und nicht finanzierbar.
Angespannte Atmosphäre: In der FAZ bezeichneten Unionskreise die Ergebnisse als „bis ins Mark frustrierend“, die Gespräche als „zäh“ und „vermint“. Die SPD habe kein Problembewusstsein und bestreite, dass eine Entlastung der Unternehmen notwendig sei, um die Wirtschaft anschieben zu können. Die Sozialdemokraten hätten laut des Berichts klassische Positionen wie den Ruf nach einer Wiederbelebung der Vermögensteuer, der Einführung einer Finanztransaktionssteuer sowie dem Abschaffen des Ehegattensplittings genannt. Letzteres soll sogar zu einem Eklat geführt haben, bei dem die SPD nach einem Wortgefecht geschlossen den Raum verlassen habe.
Innere Sicherheit: Während sich die Arbeitsgruppe „Europa“ ohne große Konflikte auf ein Papier verständigen konnte, ging es in der AG „Innen, Recht, Migration und Integration“ kontrovers zu, berichten die SZ-Kollegen. Im Zentrum der sozialdemokratischen Kritik stehen hier die Zurückweisungen an den Grenzen auch bei Asylgesuchen in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn. Unstrittig sind dagegen die Aussetzung des Familiennachzugs, die Ausweitung von Kapazitäten für die Abschiebehaft, mehr Befugnisse für die Bundespolizei und mehr Druck auf ausreisepflichtige Personen.
Wie es weitergeht: Die Verhandlungsergebnisse werden laut der Handreichung zunächst von der Steuerungsgruppe mit Thorsten Frei, Carsten Linnemann, Alexander Dobrindt, Matthias Miersch und Carsten Schneider gesichtet, die sie dann wiederum der 19-köpfigen Verhandlungsgruppe mit den Vorsitzenden und anderen Parteigranden vorlegt. Dann geht es ans Eingemachte: Noch vor dem Wochenende soll diese Runde beraten und darüber sprechen, wie die vielen Meinungsverschiedenheiten gelöst werden könnten. Im Raum stehen auch neue Untergruppen.
Zähes Zeitspiel: Über Posten und den Zuschnitt der Ressorts soll erst gesprochen werden, wenn die inhaltlichen Fragen geklärt sind. Das sollte eigentlich Anfang April so weit sein, damit die Regierung bis Ostern steht. In der Union will man sich aber offenbar doch mehr Zeit lassen, falls nötig, um die Verhandlungsposition nicht zu schwächen. Und auch mit Blick auf die Streitthemen wird der anvisierte Zeitplan Tag für Tag unrealistischer: Stattdessen könnte es nun sehr zäh werden.
In dieser Woche steht aber erst einmal die Konstituierung des neuen Bundestages an. Heute ist der letzte große Tag der Vorbereitungen: Die Fraktionen treffen sich, um letzte Details zu klären. Die CSU-Landesgruppe trifft sich um 11 Uhr im Bierkeller der Bayerischen Landesvertretung, die SPD-Fraktion um 18 Uhr im Otto-Wels-Saal des Bundestages. Auf den Tagesordnungen steht etwa die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten.
Bundestagspräsidium sucht Mitglieder: Die Unionsfraktion hat sich bereits für Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin ausgesprochen, ihre Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten stehen aber noch nicht alle fest. Klar ist bislang nur: Die Linke schickt Bodo Ramelow ins Rennen. Für die CSU-Landesgruppe sollte eigentlich Andrea Lindholz gewählt werden. Wie Table Briefings berichtet, erwägt nun aber Daniela Ludwig eine Kampfkandidatur. Noch unklar ist, wen SPD und Grüne nominieren. Auch die AfD wird einen Kandidaten aufstellen, eine Wahl gilt jedoch wieder als ausgeschlossen.
Morgen ist es dann so weit. Um 11 Uhr eröffnet Alterspräsident Gregor Gysi die erste Sitzung der 21. Wahlperiode mit einer Rede. Das geht aus der Tagesordnung hervor, die SZ Dossier vorliegt. Der Linken-Politiker betonte zuletzt oft, dies sei die einzige Rede im parlamentarischen Betrieb, die ohne Zeitbegrenzung daherkomme. Nach seiner Eröffnung steht der erste Beschluss über verschiedene Geschäftsordnungspunkte an: Dazu liegt ein Antrag von Union und SPD vor, der die Weitergeltung des Geschäftsordnungsrechts vorsieht. Anschließend wird die Bundestagspräsidentin gewählt.
Bitte übernehmen: Klöckner, deren Wahl als Formsache gilt, wird anschließend übernehmen und ebenfalls eine Ansprache halten. Dann wird zunächst die Zahl ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter festgelegt, bevor diese dann auf Empfehlung der Fraktionen gewählt werden. Ein Antrag von Schwarz-Rot sieht vor, dass jede Fraktion auch weiterhin „eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter der Präsidentin“ stellt. Die Sitzung schließt mit der Nationalhymne.
Die weitere Förderung für die Chipindustrie wird schon zu Beginn der Amtszeit auf den Tisch der neuen Bundesregierung kommen. Halbleiterhersteller hätten fast dreimal so viele Förderanträge gestellt, wie erwartet, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Quellen aus dem Wirtschaftsministerium (BMWK). Insgesamt sind es demnach mehr als 30 Anträge über sechs Milliarden Euro Fördermittel. Christiane Kühl von unserem Dossier Geoökonomie fasst die Lage zusammen.
Ein Blick auf die Anträge: Der US-Chiphersteller Globalfoundries hat einen Antrag für den Ausbau seines Dresdner Standorts eingereicht, auch Infineon soll nach unbestätigten Angaben einen Antrag gestellt haben. Das BMWK hatte ein Zwei-Milliarden-Programm aufgelegt, um Globalfoundries zu besänftigen: Die Amerikaner hatten sich durch die hohen Subventionen für den Weltmarktführer TSMC aus Taiwan stark benachteiligt gefühlt und eine Klage in Brüssel erwogen. Berlin hatte TSMC mit fünf Milliarden Euro staatlicher Zuschüsse nach Dresden gelockt. Das Werk ist im Bau.
Knackpunkt Finanzierung: Anders als bei den Milliarden-Zuschüssen für die TSMC-Fabrik, die der Bund über die europäischen Chip-Gesetze allein stemmt, müssen bei den neuen Anträgen laut der Sächsischen Zeitung die betreffenden Bundesländer 30 Prozent der Summe kofinanzieren. Im Falle Globalfoundries könne das klamme Sachsen die Summe nicht aufbringen. Laut Bloomberg will jede Dritte der Firmen, die solche Mittel beantragten, in Ostdeutschland investieren – wo überall die Mittel knapp sind.
Punkt für Dresden: Merz hat bereits angedeutet, dass er an der Förderung des Chipsektors festhalten wolle. Deutschland ist der größte Chipexporteur in Europa. Dass es zur Finanzierungsstruktur der Fördermittel Gespräche mit Berlin gegeben habe, wie Bloomberg schreibt, wollte das Wirtschaftsministerium in Dresden der Sächsischen Zeitung allerdings nicht bestätigen. Stattdessen betonte man, die Zukunftsfähigkeit der europäischen Halbleiterindustrie dürfe nicht von den knappen Ressourcen Sachsens abhängen.
Der türkische Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu ist als Istanbuler Bürgermeister „vorübergehend“ abgesetzt worden. Das gab das türkische Innenministerium gestern bekannt. Begründet wurde die Absetzung mit der Untersuchungshaft, die im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen von der Istanbuler Staatsanwaltschaft gegen İmamoğlu verhängt wurde. Der Vorgang gilt als beispiellos, im Land finden die größten Proteste seit Jahren statt. Dabei kam es zu hunderten Festnahmen. Auch in Berlin haben gestern in Charlottenburg mehr als 1000 Menschen für die Freilassung İmamoğlus demonstriert.
Scharfe Kritik von der Bundesregierung: Das Vorgehen sei ein schwerer Rückschlag für die Demokratie in der Türkei, sagte gestern ein Sprecher des Auswärtigen Amts. „Politischer Wettbewerb darf nicht mit Gerichten und Gefängnissen geführt werden. Wir erwarten, dass die Vorwürfe schnellstmöglich transparent aufgeklärt werden und es ein Verfahren auf Basis rechtsstaatlicher Prinzipien gibt“, hieß es weiter. SPD-Chef Klingbeil forderte im Tagesspiegel die Freilassung von İmamoğlu und allen mit ihm Inhaftierten: „Die Türkei darf nicht weiter Richtung Autokratie abrutschen“, sagte Klingbeil.
Was bisher geschah: Der Politiker wurde am Mittwoch gemeinsam mit weiteren Menschen festgenommen, nur wenige Tage vor seiner geplanten Nominierung als Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei CHP. Ihm werden in zwei getrennten Verfahren Vorwürfe im Zusammenhang mit Terrorismus und Korruption gemacht. Zahlreiche Menschen nahmen gestern an der Wahl İmamoğlus zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei teil: Er ist der einzige Kandidat und gilt als aussichtsreicher Konkurrent des regierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.
Wie es weitergehen könnte: Offizieller Kandidat ist İmamoğlu erst, wenn die als regierungsfreundlich geltende türkische Wahlbehörde seine Kandidatur bestätigt. Sollten die Terrorermittlungen bis dahin nicht eingestellt werden, ist eine Annahme seiner Kandidatur unwahrscheinlich. Zudem wurde İmamoğlu in dieser Woche der Universitätsabschluss aberkannt. Die Entscheidung ist noch nicht endgültig, ein Abschluss ist Voraussetzung für eine Präsidentschaftskandidatur. İmamoğlu wies alle Vorwürfe zurück und sprach auf X von einem „politischen Putsch“.
Tiefgang
Friedrich Merz will sich der Forderung nach einem paritätisch besetzten Kabinett nicht anschließen. „Wir haben jetzt wieder nur leider 25 Prozent Frauen in der Bundestagsfraktion, der Anteil im Kabinett wird höher“, antwortete er am Freitag bei einer Veranstaltung der FAZ auf eine entsprechende Frage, ohne aber auf die Forderung aus den eigenen Reihen einzugehen.
Zuvor kursierte ein Brief von Mechthild Heil, der Vorsitzenden der „Gruppe der Frauen“ in der CDU/CSU-Fraktion. In dem Schreiben, das SZ Dossier vorliegt, schreibt Heil: „Wir fordern Parität, einen Frauenanteil von 50 Prozent, bei den zu besetzenden Positionen innerhalb der Fraktion, in weiteren Gremien, bei Beauftragungen und bei der bevorstehenden Regierungsverantwortung.“
Wie sie ausführt, hätten die Unions-Frauen zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Frauenanteil in den Arbeitsgruppen der CDU bei 27,1 Prozent und bei der CSU bei 31,25 Prozent liegt. In der SPD hingegen beträgt der Anteil 49,1 Prozent. „Dazu kommt der Rückgang des Frauenanteils in unserer eigenen Fraktion, der nun nur noch 23 Prozent beträgt“, schreibt Heil.
Unvergessen ist auch das Bild des ursprünglichen Sondierungsteams von CDU und CSU: Sechs Männer, drei pro Partei, keine einzige Frau. Im Brief heißt es: Es sei wichtig, dass Frauen in politischen Entscheidungsprozessen angemessen vertreten seien und ihre Perspektiven aktiv einbringen könnten. „Denn auch für die politische Arbeit gilt: Gemischte Teams sind erfolgreicher“, schreibt Heil.
Die Diplom-Ingenieurin und Architektin sollte eigentlich in der Arbeitsgruppe Familie mitverhandeln, wie sie der Tagesschau mitteilte, lehnte es jedoch ab. Es gebe viele fähige Frauen in der Union, sagte sie, die alle möglichen Ämter ausüben könnten. Aber weder im Konrad-Adenauer-Haus noch in der Unionsfraktion sei bekannt, wer welche Kompetenzen habe.
Merz hängt bereits seit Jahren ein antiquiertes Frauenbild an, das er zuletzt durch einige Aussagen befeuerte. So sagte er im November 2024 bei RTL, er halte wenig von einer geschlechterparitätischen Besetzung seines Kabinetts. Dabei verwies er auf die Arbeit von Ex-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und sagte, das sei eine „so krasse Fehlbesetzung“ gewesen, die man nicht wiederholen wolle.
Er fügte damals hinzu: „Wir tun damit auch den Frauen keinen Gefallen.“ Ihre Arbeit als Justiz- und Familienministerin sowie die eine oder andere männliche Fehlbesetzung aus der Union blieben unerwähnt. Merz betonte aber schon damals, er versuche, Frauen in Partei und Fraktion in Verantwortung zu bringen. Und es war Merz, der 2022 bei seinem ersten Parteitag als Vorsitzender eine auf fünf Jahre befristete 30-Prozent-Frauenquote für Vorstandsämter durchsetzte.
Aufgegangen ist seine Strategie nicht, wie die Zahlen der neuen Fraktion zeigen. Und auch in der Partei sind nur etwas mehr als 25 Prozent der Mitglieder weiblich. Darauf ging der CDU-Chef auch am Freitag ein: „Es ist eine schwierige Aufgabe“, sagte Merz. Er habe sich in den letzten Monaten „intensivst“ bei verschiedensten Gelegenheiten darum bemüht, auch Frauen zu ermutigen, für den Bundestag zu kandidieren.
Da gebe es aber ein Problem. Ein „Luxusproblem“, wie Merz betonte. „Wir gewinnen in Deutschland die Mehrzahl der Wahlkreise und darauf hat der Parteivorsitzende kaum Einfluss. Da werden halt Kandidatinnen oder eben Kandidaten aufgestellt, je nachdem wie die Wahlkreise das wollen, und dann hat man über die Landeslisten wenig Einfluss auf die Zusammensetzung“, erläuterte er.
„Ich bedauere das zutiefst“, schob der CDU-Chef hinterher. Aber man fange gut an: Er habe Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin vorgeschlagen, sagte Merz. „Also wir werden schon das zweithöchste Staatsamt der Bundesrepublik Deutschland aus unseren Reihen mit einer Frau besetzen“, sagte er. Und auch die Nachbesetzung von Klöckner im CDU-Präsidium werde mit einer Frau stattfinden. Sein Fazit: Er tue, was er könne, sagte Merz, spiele den Ball aber zurück an die „Damen“ im Publikum. „Ich kann es mir ja nicht malen. Wir brauchen Sie.“
Grünen-Chefin Franziska Brantner kritisierte am Wochenende, dass sich unter Merz ein Aderlass an Frauen bemerkbar gemacht habe, auch schon vor der Wahl. „Zu viele haben ihre Zukunft nicht mehr im Bundestag gesehen“, sagte Brantner der dpa. Mit Blick auf den Bericht der Tagesschau sagte sie zudem, es sei „bezeichnend, dass Frau Heil als ausgewiesene Baupolitikerin in den Familienbereich verfrachtet wurde“. Solche Entscheidungen zeugten von einem „längst überwunden geglaubten Verständnis von Frauen in der Politik, das Frauen auf angeblich weibliche Themen beschränkt“, anstatt ihre Stärken dort zu nutzen, wo sie vorhanden seien.
Wie die Journalistin Sara Sievert in ihrer Merz-Biografie schreibt, seien die Gespräche des CDU-Vorsitzenden, etwa in den Gremien, größtenteils männlich geprägt. Das treffe auch auf sein enges Umfeld in der Partei zu. Zu den bekannten Zahlen in Fraktion und Partei kommt: Es gibt derzeit keine einzige weibliche Landesvorsitzende. Sieverts Fazit: „Gehen die Dinge einfach so weiter, wird die CDU unter Merz wieder zu der Altherrenpartei, die sie Ende der 90er-Jahre war.“
Fast übersehen
Pöbelndes Parlament: Im Bundestag wurde in dieser Legislatur so viel beleidigt und gestört wie noch nie. Wie Daten des Parlaments zeigen, gab es insgesamt 136 Ordnungsrufe und 26 Rügen. Nur in der allerersten Wahlperiode des Hohen Hauses gab es mehr Ordnungsrufe. Von den 136 Ordnungsrufen gingen 85 aufs Konto der AfD, 13 an fraktionslose Abgeordnete, die zuvor Mitglied der AfD-Fraktion waren. Es folgen: SPD (11), BSW (8), Grüne (7), Linke (6), Union (4) und FDP (2).
Immer weniger Respekt: Allein 20 Ordnungsrufe bekamen jeweils die AfD-Abgeordneten Stephan Brandner und Beatrix von Storch. Aus den Daten geht laut eines Stern-Berichts hervor: Wenn andere Fraktionen zur Ordnung gerufen werden, geht es meist um die AfD. Was die Rügen angeht, ist die Verteilung ähnlich: 14 gingen an die AfD, vier an die SPD, drei an die Grünen, zwei an die Linken und jeweils eine an die FDP und an einen fraktionslosen Abgeordneten. Brandner, der dreimal gerügt wurde, ist hier alleiniger Spitzenreiter.
Der FDP-Vorsitz formiert sich. Die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann soll stellvertretende Vorsitzende der Freien Demokraten werden. Wie der Spiegel am Samstag unter Berufung auf Parteikreise berichtete, soll Strack-Zimmermann zu einem Team um Christian Dürr gehören, der seinerseits FDP-Chef werden will.
Reise nach Straßburg: Er war es auch, der sich dafür ausgesprochen hatte, dass Strack-Zimmermann und FDP-Vize Wolfgang Kubicki Teil des neuen Präsidiums werden sollen. Laut des Berichts soll es nun in der vergangenen Woche in Straßburg ein klärendes Gespräch zwischen Dürr und Strack-Zimmermann gegeben haben.
Im Mai wird gewählt: Kubicki wiederum sagte dem Tagesspiegel am Wochenende: „Seit zwölf Jahren bin ich erster Stellvertreter – und das soll so bleiben.“ Seine Kandidatur entspreche „auch dem Willen von Christian Dürr und seinen Vorstellungen eines schlagkräftigen Teams“. Dürr hatte bei Bekanntgabe seiner Kandidatur angekündigt, „ein Team aus neuen Köpfen und bekannten Gesichtern“ anführen zu wollen. Insgesamt gibt es in der Partei derzeit drei stellvertretende Vorsitzende. Gewählt wird beim Bundesparteitag in Berlin im Mai.
Rot-Grüne Koalitionsverhandlungen: In Hamburg will die SPD mit den Grünen über eine Koalition verhandeln. Das entschied der SPD-Landesvorstand am Samstagabend. Die Verhandlungen sollen in den nächsten Tagen beginnen. Sollte es zu einem erfolgreichen Abschluss kommen, könnte der rot-grüne Senat seine Regierungsarbeit weiterführen. Die Sozialdemokraten hatten auch einige Wochen lang mit der CDU sondiert.
Unter eins
Verkehrs- und Justizminister Volker Wissing sagte im Interview mit dem RND, die FDP müsse ein Generalangebot machen und kein Spezialangebot
Zu guter Letzt
Am 27. März 2028 erobert Russland eine estnische Stadt mit 57.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und besetzt eine Insel vor dem Baltenstaat: Der Militärexperte Carlo Masala entwickelt in seinem neuen Buch „Wenn Russland gewinnt“ (C.H. Beck) ein hypothetisches Szenario, das er auf 116 Seiten spannend beschreibt. Dem Autor geht es um die Frage: Wird die Nato den Bündnisfall ausrufen – oder aber Estland allein lassen? Dabei nimmt er die Leserinnen und Leser mit in die Maschinenräume der Weltpolitik, lässt sie an den Gedankengängen der Akteure teilhaben.
Im Vor- und Nachwort ordnet Masala seine Annahmen ein: Das nach „wissenschaftlichen Maßstäben“ entwickelte Szenario orientiere sich an realen Gegebenheiten, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Gesprächen mit Experten und Entscheidern. In der Tat erinnern gleich verschiedene Szenen an wahre Begebenheiten: Im Szenario begründet Moskau den militärischen Akt mit der Unterdrückung der russischen Minderheit, was später auch zum talking point des US-Präsidenten wird, zudem gibt es verschiedene Akte hybrider Kriegsführung.
Masalas Ziel ist es, mit dem fiktiven Fall zum Nachdenken anzuregen. „In der Regel spielt man Szenarien durch, damit das nicht eintritt, was in ihnen beschrieben wird“, mahnt er. Die Zukunft sei offen. Es komme aber darauf an, schreibt er im Nachwort, den Eindruck zu erwecken, dass die Nato wirklich fähig und willens sei, jeden Quadratmeter des eigenen Territoriums zu verteidigen.