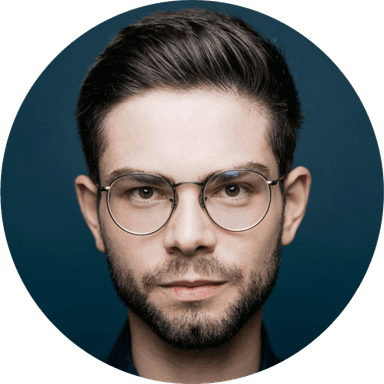Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerben
So lief die Konstituierung des neuen Bundestages
Mittwoch, 26. März 2025Guten Morgen. Deutschland hat jetzt eine geschäftsführende Bundesregierung. Nach der konstituierenden Sitzung des Bundestages, bei der die Regierungsbank leer blieb, haben Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Ministerinnen und Minister im Schloss Bellevue ihre Entlassungsurkunden erhalten.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, die Welt habe sich in den vergangenen drei Jahren in einer Geschwindigkeit verändert, wie er es in seiner politischen Erinnerung nicht erlebt habe. „Sie als Bundesregierung mussten sehr oft sehr schnell und entschlossen handeln“, sagte er. Er sprach über die Pandemie, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, das Sondervermögen für die Bundeswehr, die Energieversorgung im ersten Kriegswinter.
Die Regierung bleibt nun auf Bitten des Bundespräsidenten geschäftsführend im Amt, bis der neue Bundestag einen neuen Kanzler gewählt hat. Und das kann noch dauern: Heute schauen wir auf die zentralen Unstimmigkeiten, die sich aus mehreren geleakten Papieren der schwarz-roten Arbeitsgruppen ergeben. In einer Word-Datei waren sogar noch die Kommentare von Mitarbeitenden zu lesen.
Willkommen am Platz der Republik.
Was wichtig wird
Die Unterhändler haben sich an die Anweisungen gehalten. Das Papier der AG Innen, Recht, Migration und Integration, das gestern die Runde machte, ist in Calibri und Schriftgröße 11 verfasst. Vieles ist, „Stand 24.03.2025, 19.00 Uhr“ allerdings noch in Blau und Rot geschrieben – und nicht in Schwarz, dem Farbton für geeinte Forderungen.
Innen: So steht etwa in Blau und eckiger Klammer, also als Formulierungsvorschlag der Union, die Forderung nach einer neuen Nationalen Sicherheitsstrategie, einem nationalen Sicherheitsrat und einem nationalen Sicherheitskoordinator. Außerdem, so das Papier, würde die Union gerne die automatisierte Gesichtserkennung an Bahnhöfen, Flughäfen und „anderen Kriminalitäts-Hotspots“ einführen, um schwere Straftäter zu identifizieren. Geeint ist das aber wohl nicht. Die SPD hingegen hätte gerne „eine rechtliche Grundlage für die Bundestagspolizei“.
Recht: Im Bereich Recht gibt es zum Beispiel beim Thema Cannabis noch offene Fragen. Die Union würde die Teillegalisierung dem Papier zufolge gerne rückgängig machen. Ergebnis offen. Gleiches gilt beim Thema Schwangerschaftsabbruch: Die SPD will das außerhalb des Strafrechts regeln und Abbrüche nach der Beratungslösung in der Frühphase rechtmäßig stellen.
Migration und Integration: Bei einem der umstrittensten Themen der Koalitionsverhandlungen sind ebenfalls noch Punkte in der Arbeitsgruppe offen. Etwa die Forderung der Union, Asylverfahren in Drittstaaten zu ermöglichen. Keine Verständigung gibt es demnach auch auf den Vorschlag von CDU und CSU, wonach der Bund „Bundesausreisezentren in der Nähe von großen deutschen Flughäfen“ betreiben solle, um Abschiebungen zu erleichtern. Auch waren die SPD-Unterhändler wohl nicht einverstanden damit, Sozialleistungen für Ausreisepflichtige „auf das verfassungsrechtlich Erforderliche zu kürzen“, sofern die Ausreise unverschuldet nicht stattfand. Beim Chancenaufenthaltsrecht gehen die Positionen ebenfalls auseinander: Die SPD will es verlängern, die Union will es auslaufen lassen.
Staatsangehörigkeit: Dem Papier zufolge gibt es selbst bei Formulierungen aus dem Sondierungspapier wieder Dissens. In Rot und eckiger Klammer steht im Dokument der Arbeitsgruppe der Satz: „Wir halten an der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts fest.“ Im Sondierungspapier ging die Formulierung weiter: Es solle verfassungsrechtlich geprüft werden, ob Terrorunterstützern, Antisemiten und Extremisten, die dazu aufrufen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden kann; unter der Voraussetzung, dass sie eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen. Die Union will dagegen noch weiter gehen und plädiert etwa dafür, dass jede Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat eine Einbürgerung verhindert. Außerdem sollen sich Einbürgerungsbewerber zum Existenzrecht Israels bekennen.
In dem als „geeint“ bezeichneten Papier der Arbeitsgruppe 12, „Verteidigung, Außen, Entwicklung, Menschenrechte“, das ebenso kursiert wie das der Innen-AG, sind insbesondere jene Punkte noch strittig, die sich entlang bekannter Parteilinien bewegen. So findet sich die von der SPD geforderte Formulierung zu einer Zweistaatenlösung im Nahostkonflikt nicht in dem Text, der an die Steuerungsgruppe weitergegeben wurde.
Detailfragen: Auch die Ablehnung der Annektierung von palästinensischen Gebieten durch Israel, wie sie Sozialdemokraten wollen, hat es nicht in den Wortlaut geschafft, sondern steht nur als „ALT“ – in Rot und eckigen Klammern – im Papier. Die vonseiten der Union kritisch gesehene Finanzierung des UN-Hilfswerks für palästinensische Geflüchtete UNRWA ist ebenfalls ein Punkt, der nur noch pro forma im Papier steht.
Bei der humanitären Hilfe haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe 12 hinter dem Satz „Wir werden zukünftig eine auskömmliche Finanzierung der Humanitären Hilfe und Krisenprävention sicherstellen“ den Hinweis „Strittige Strukturfrage“ hinterlassen. Die Forderungen der SPD, die Aussöhnung mit Namibia als „eine unverzichtbare Aufgabe“ sowie das Bekenntnis zur Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung in den Koalitionsvertrag aufzunehmen, sind weiterhin rot. Dafür ist wohl die von der Union geforderte „bedarfsgerechte“ Unterstützung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge noch strittig.
Entwicklungspolitik: Ebenfalls strittig ist laut des Dokuments die Frage, welche Rolle die Entwicklungspolitik spielen soll. Die Union will „das BMZ in das Auswärtige Amt integrieren“, damit Synergieeffekte entstehen. Die SPD will hingegen „den integrierten Ansatz durch eine bessere Zusammenarbeit von AA, BMZ und BMVg stärken“ und „kohärent aufeinander abstimmen“.
Zur Finanzierung der Verteidigung ist in dem Papier hervorgehoben, dass „der Zyklus einer Legislaturperiode für die Umsetzung weitreichender Beschaffungs- und Rüstungsprojekte regelmäßig zu kurz“ sei. Die Koalitionäre streben deshalb die Einführung eines mehrjährigen Investitionsplans in die Verteidigungsfähigkeit an. So soll langfristig finanzielle Planungssicherheit gewährleistet sein, um den Bedarfen der Bundeswehr und den Verpflichtungen gegenüber der Nato und ihren Fähigkeitsforderungen gerecht zu werden.
Streitpunkt Wehrpflicht: In roten Lettern und gelb hervorgehoben steht hinter diesem Punkt „nicht geeint“. Die Union will die Aussetzung der Wehrpflicht beenden und fordert einen „konsequenten und raschen Aufwuchs unserer Streitkräfte“. Die SPD setzt beim „neuen Wehrdienst“ auf Freiwilligkeit: „Wir werden dazu noch in diesem Jahr die Voraussetzungen für eine Wehrerfassung und Wehrüberwachung schaffen“, heißt es im Papier der Arbeitsgruppe dazu in Rot. Man wolle eine „breite gesamtgesellschaftliche Diskussion zur Einführung eines neuen attraktiven Dienstes für alle Bürgerinnen und Bürger“.
Laut dem Papier der Arbeitsgruppe Verkehr, Infrastruktur, Bauen und Wohnen haben sich die Unterhändler auf Änderungen beim Gebäudeenergiegesetz (GEG) – besser bekannt als Heizungsgesetz – verständigt. Konkret heißt es darin: „Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen.“ Geplant sei ein neues Recht, „das einen Paradigmenwechsel weg von einer kurzfristigen Energieeffizienzbetrachtung beim Einzelgebäude hin zu einer langfristigen Betrachtung der Emissionseffizienz vollzieht“. Die Heizungsförderung solle aber fortgesetzt werden. Zuerst hatte Table Media darüber berichtet.
Wirklich einig? In einem Papier aus der Arbeitsgruppe Klima und Energie taucht die Passage ebenfalls auf, geschrieben allerdings in Blau und eckiger Klammer. Im roten Farbton der SPD-Verhandelnden heißt es, man wolle das Gebäudeenergiegesetz zügig novellieren. Und weiter: „Die geltenden Regelungen werden wir technologieoffener, flexibler und einfacher machen und mit verlässlicher, unbürokratischer und effizienter und sozial gestaffelter Förderung flankieren.“ Offenbar gibt es hier also zwischen den AGs noch Klärungsbedarf. Eine endgültige Entscheidung trifft aber ohnehin die Verhandlungsgruppe. Außerdem steht alles unter Finanzierungsvorbehalt.
Wichtiges Symbol: Aus symbolischer Sicht wäre die Abschaffung des Heizungsgesetzes vor allem für die Union wichtig. Es ist eine der Forderungen aus ihrem Wahlprogramm. Allerdings sprach sich auch Bauministerin Klara Geywitz (SPD) dafür aus, das Gebäudeenergiegesetz deutlich einfacher zu gestalten. Ohnehin deuten die Textpassagen nun eher auf eine Reform als auf eine komplette Abschaffung des GEG hin, schließlich ist im Text mehrfach vom GEG die Rede, etwa in Form von besserer Verzahnung von GEG und Wärmeplanung. Wie die dpa berichtet, könnten aber die als kleinteilig kritisierten Regeln für den Heizungstausch in Paragraf 71 des GEG abgeschafft oder zumindest grundlegend reformiert werden.
Was die SPD bekommt: Table Media berichtete zuvor von einem „Deal“, bei dem auf Seiten der SPD eine Forderung der Jusos zum Tragen kommen sollte. Die hatten im Wahlkampf gefordert, Studierende und Auszubildende sollten nicht mehr als 400 Euro für ein WG-Zimmer bezahlen. Das Wort „WG-Garantie“ ist nun immerhin Teil des Verhandlungsergebnisses. Konkret drückt sie sich etwa dadurch aus, dass Mittel für „Junges Wohnen“ verdoppelt werden. In das Programm flossen laut Bundesbauministerium 2023 Bundesmittel in Höhe von 500 Millionen Euro. Es soll jungen Menschen helfen, eine Wohnung zu finden, etwa durch die Förderung von Wohnheimplätzen. Strittig zwischen SPD und CDU/CSU ist laut Papier, wer künftig das Wohngeld zahlt: Die Union will diese Sozialleistung ganz über den Bund finanzieren.
Noch bei jedem neuen Kabinett gab es Überraschungen bis zum Tag der offiziellen Vorstellung. Dass sich ein potenzieller Minister aber wegen einer gewalttätigen Aktion gegen seine Familie mitten in den Koalitionsverhandlungen zurückzieht, ist neu. Günther Felßner, Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, berichtete gestern in drastischen Worten von dem, was am Montag auf seinem Hof passierte.
Dramatische Szenen: Vermummte Demonstranten kletterten auf das Dach eines Stalles, in dem sich neben Tieren auch Felßners Frau und ein Mitarbeiter befanden, dann drang Rauch von Bengalos von draußen in das Gebäude. „Meine Frau hatte Angst um Leib und Leben.“ Felßner selbst war wegen der Koalitionsverhandlungen in Berlin.
Schwarzer Tag: Die Gefährdung der Familie mit drei Kindern und Opa, die „unkalkulierbare Bedrohung“ durch Gruppen wie „Animal Rebellion“ habe ihn bewogen, sich nicht mehr zur Verfügung zu stellen, das sei ein „schwarzer Tag für die Demokratie“. Mit auch harten Kontroversen über die richtige Landwirtschaft habe er kein Problem, aber mit Gewalt. CSU-Chef Markus Söder sprach von gefährlichen Gruppen, gegen die es „null Toleranz“ geben dürfe.
Gerüchte dementiert: Felßner war von Söder schon vor der Bundestagswahl als künftiger Agrarminister nominiert worden. Bei der Wahl hatte er kein Bundestagsmandat gewonnen, weil er nur auf der Landesliste und nicht in einem Wahlkreis kandidierte. Gerüchte aus den vergangenen Tagen, in der CSU-Landesgruppe in Berlin habe die Begeisterung für den Seiteneinsteiger schon nachgelassen, nannte Felßner „Schwachsinn“.
Söder besteht auf Ministerium: Auch Söder versicherte, erst die Attacken seit Freitag seien ausschlaggebend dafür gewesen, dass Felßner ihn am Montag über seinen Rückzug verständigt habe. Der Landwirt sei ein „toller Mensch“. Das Ministerium selbst beansprucht Söder weiter für die CSU, einen neuen Namen wollte er aber vorab nicht nennen. Infrage käme etwa die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.
Tiefgang
Schon weit vor Beginn der konstituierenden Sitzung des 21. Deutschen Bundestages sitzen die Abgeordneten der AfD auf ihren Plätzen. Vor den blauen Sitzreihen macht Beatrix von Storch ein Selfie mit Maximilian Krah, Alexander Gauland und einigen anderen Parlamentariern. Kurz vor der Sitzung bahnt sich Bundeskanzler Olaf Scholz den Weg durch die AfD-Abgeordneten – und nimmt Platz in der ersten Reihe der SPD-Fraktion. Um elf Uhr betritt dann Alterspräsident Gregor Gysi den Saal. Als er eine Minute später den Abgeordneten Bernd Baumann aufruft, ertönt zum ersten Mal der neue Sound der AfD.
Die neue Größe der AfD: Als die 152 Abgeordneten applaudieren, wird deutlich, wie sehr die neue Fraktionsgröße ins Gewicht fällt: Rein optisch, in der ersten Reihe sind jetzt vier Plätze – aber eben auch akustisch. Falls Union und SPD eine Regierung bilden sollten, wird Alice Weidel Oppositionsführerin. Sie wird dann diejenige sein, die nach dem Kanzler spricht – und damit die Debatten maßgeblich prägen wird.
Keine zwei Minuten hat Baumann gesprochen, als Gysi zum ersten Mal intervenieren muss. „Ich bitte Sie, zur Geschäftsordnung zu sprechen“, mahnt er Baumann, der zur Grundsatzrede ausholt. Die AfD beschwert sich, dass nicht der älteste Abgeordnete die Sitzung eröffnet, in dem Fall Gauland, sondern der dienstälteste. Die neue Größe der AfD wird sich auch in der Redezeit und Besetzung von Ausschüssen widerspiegeln. Und eben in der Sitzordnung. Sogar die Bundestagsverwaltung leistet sich hier einen Fauxpas: Im AfD-Block fehlen sieben Stühle.
Wie sich der Alterspräsident verzettelt: Als Gysi mit knapp zwanzig Minuten Verspätung die Sitzung eröffnet, erwarten die Abgeordneten eine fulminante Rede. Er begrüßt den ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, der ihn früher regelmäßig wegen seiner Redezeit ermahnt hatte. Gysi hat für seine Rede als Alterspräsident keine Zeitbegrenzung. „Ich werde das Recht nicht missbrauchen“, sagt er. Auf der Besuchertribüne wiegt Lammert skeptisch den Kopf hin und her.
Gysi gilt als rhetorisch stark – und startet gut in die Rede, obwohl er sie fast komplett abliest. Er spricht über verschiedene Haltungen zum Thema Frieden: „Wenn wir mehr Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung erreichen wollen, sollten wir in unserer Sprache das Maß wahren, nicht immer bei Menschen mit anderer Auffassung das Übelste unterstellen“, sagt er. Dann springt Gysi plötzlich: Es geht um den Nahen Osten, um weiterführende Schulen, um die Energiekrise – und um die unterschiedliche Besteuerung von Weihnachtsbäumen. Friedrich Merz muss lachen.
Einen starken Moment hat der Alterspräsident, als es um die Wiedervereinigung geht: Es sei ein schwerer Fehler bei der Einheit gewesen, dass man die DDR auf Stasi und Mauertote reduziert habe. Die DDR sei etwa bei der Gleichstellung der Geschlechter weiter gewesen, übernommen habe man aber nur Sandmännchen, Ampelmännchen und den grünen Abbiegepfeil.
Gysi fordert den künftigen Bundeskanzler auf, sich dafür zu entschuldigen: „Das gäbe einen wirklichen Ruck bei der Herstellung der inneren Einheit.“ Notwendig sei weiterhin eine Gleichstellung von Ost und West, es müsse etwa Schluss sein mit unterschiedlichen Tarifverträgen, Ostdeutsche sollten in der nächsten Bundesregierung angemessen vertreten sein. Dann geht es wieder um Außenpolitik, es geht ein Raunen durch den Plenarsaal: Gysi kann kaum einen Punkt setzen, der in Erinnerung bleibt, sondern frühstückt in 38 Minuten alle Themen ab, teils parteipolitisch gefärbt, ohne konkret zu werden.
Wie sich Julia Klöckner als Versöhnerin inszeniert: Die Wahl der Bundestagspräsidentin verläuft so, wie sie sich Julia Klöckner vorgestellt hatte. Um 13:32 Uhr gibt Gysi das Ergebnis bekannt: 382 Ja-Stimmen, 204 Nein-Stimmen, 31 Enthaltungen. Notwendig waren 316 Stimmen: Klöckner hat es geschafft. Alle Fraktionen gratulieren, am Ende auch die erste Reihe der AfD.
„Guten Tag“, sagt Klöckner, als sie ans Mikrofon tritt. In ihrer Rede betont die ehemalige Agrarministerin, sie wolle ihre Aufgabe stets unparteiisch, unaufgeregt und unverzagt erfüllen. „Klar in der Sache, aber verbindend im Miteinander“, betont sie. Angesichts des schwindenden Vertrauens brauche es eine neue Vertrauensbeziehung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und ihren Volksvertretern. Sie werde nicht nur zur Einhaltung der Redezeiten auf die Uhr schauen, sondern auch hinhören: zum Rednerpult und in den Saal hinein. Hier gebe es einen Gradmesser, nämlich den Anstand: „Ich werde darauf achten, dass wir ein zivilisiertes Miteinander pflegen.“
Ihr Credo: das Aushalten des Meinungsspektrums im Rahmen der Verfassung. „Nicht jede Meinung, die ich selbst nicht teile, kommt dem Extremismus gleich“, sagt Klöckner. Hier gibt es Applaus von der AfD. Ein paar Ankündigungen hat sie auch: Sie werde sich nicht verschließen, über Einsparungen bei der Bundestagsverwaltung nachzudenken, wolle eine Reform der Geschäftsordnung hinbekommen. Und: Der Bundestag soll das modernste Parlament der Welt werden, etwa bei der Digitalisierung der parlamentarischen Arbeit.
Dann wird es staatstragend. „Wir vertreten ein ganzes Volk“, sagt Klöckner. Es gehe ihr darum, ein „hörendes Herz“ zu haben, sagt sie und zitiert damit Papst Benedikt. „Erst zusammen sind wir Deutschland, niemand ist Deutschland allein.“ Optimismus müsse wieder durchs Land gehen, sagt sie am Ende ihrer Rede. Und schließt mit Gottes Segen.
Business as usual bei der Stellvertreterwahl: Nach einigen Anfangsschwierigkeiten werden Klöckners Stellvertreterinnen und Stellvertreterinnen gewählt. Zuvor hatte die neue Bundestagspräsidentin versehentlich einen Tagesordnungspunkt übersprungen. „Fängt ja gut an“, sagt sie.
Als Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten gewählt werden Andrea Lindholz (CSU) mit 425 Ja-Stimmen, Josephine Ortleb (SPD) mit 434 Ja-Stimmen, Omid Nouripour (Grüne) mit 432 Ja-Stimmen und Bodo Ramelow (Linke) mit 318 Ja-Stimmen. Der AfD-Kandidat Gerold Otten erhält zwar bei der geheimen Wahl mehr Stimmen, als die AfD-Fraktion Abgeordnete hat, fällt aber durch – auch im dritten Wahlgang. Es bleibt auch in der neuen Legislatur dabei: Die Kandidierenden der AfD bekommen keine Mehrheit.
Fast übersehen
Trend nach oben: Wäre noch Wahlkampf, würde Carsten Linnemann jetzt wohl vom „Merz-Aufschwung“ reden. Zwar befindet sich der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts immer noch im Krisenbereich, aber das Schlimmste könnte vorüber sein. Der Index kletterte auf 86,7 Punkte nach 85,3, wobei vor allem die Erwartungen einen kleinen Sprung nach oben machten. „Die deutsche Wirtschaft hofft auf Besserung“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Wendepunkte in der Konjunktur sind manchmal wichtiger als die eigentlichen Zahlen, aber noch ist es keine offizielle Erholung. Von Reuters befragte Analysten sehen einen Zusammenhang zu den Verfassungsänderungen, die höhere Investitionen ermöglichen.
Mehr Bauaufträge: Schon vor der Bundestagswahl haben sich die Aufträge im Bau stabilisiert. Im Januar legten die Bestellungen gegenüber Dezember um 5,2 Prozent zu, im Vergleich zum Januar 2024 sogar um 10,3 Prozent. Der Ifo-Index für das Bauhauptgewerbe ist daher auch der beste seit einem Jahr – aber mit minus 24,6 steht der Index immer noch tief im Minus verglichen mit dem Basisjahr 2015. Nur wird der Bau ziemlich sicher von Konjunkturprogramm und Bürokratieabbau profitieren, während das verarbeitende Gewerbe weiter den Zollkrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt fürchten muss. Dort ist die Stimmung auch besser als am Tiefpunkt zum Jahreswechsel, aber noch immer schlechter als vor einem Jahr.
Zu marode für Panzer: Die Infrastruktur, die für militärische Einsätze im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung unverzichtbar ist, erscheint im Kriegsfall eher untauglich. Wenn über Deutschlands Straßen und Schienen Truppenkontingente und militärisches Gerät an eine mögliche Front im Osten transportiert werden müssten, müssten sie zahlreiche Straßen und Brücken überqueren, die den tonnenschweren Panzern im Zweifelsfall nicht gewachsen sind.
Das Geld muss auf die Straße: Bereits im vergangenen Jahr kritisierte die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), dass die marode Infrastruktur des Landes die Mobilität der Streitkräfte massiv beeinträchtige. Umso wichtiger sei es deshalb, dass Bundeswehr und EU-Kommission in der vergangenen Woche die wichtigsten Strecken und Baumaßnahmen identifiziert haben, sagte der Autor des Papiers, Jannik Hartmann, meiner SZ-Kollegin Sina-Maria Schweikle.
Europäischer Regelsalat: Nun komme es darauf an, die Transportvorschriften zwischen EU- und Nicht-EU-Ländern – aber auch zwischen den deutschen Bundesländern – zu harmonisieren. Denn nicht nur marode Straßen, sondern auch zahlreiche Richtlinien beschränken den schnellen Transport von militärischem Gerät in Deutschland und der EU. Vor wenigen Wochen erst hat der Europäische Rechnungshof den EU-Aktionsplan zur militärischen Mobilität unter die Lupe genommen. Dabei kam er zu einem ernüchternden Ergebnis: Die Streitkräfte der EU-Staaten seien nach wie vor nicht in der Lage, sich schnell innerhalb der Union zu bewegen.
Unter eins
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnte am Rande der konstituierenden Bundestagssitzung vor dem Scheitern einer Koalition der Mitte
Zu guter Letzt
Es ist ein massives Sicherheitsleck. Es ist das „Spitzenpersonal der angeblichen Führungsmacht der freien Welt“, das sich „auf dem Niveau von Teenagern bewegt“, wie mein SZ-Kollege Hubert Wetzel kommentiert. Und: Ein Einblick in Denkweisen, die Europas Rolle neu vermessen.
In der Signal-Chatgruppe „Houthi PC small group“, in die versehentlich ein Journalist eingeladen wurde, teilten führende Mitglieder der obersten US-Sicherheitsriege höchst sensible Daten zu Luftangriffen im Jemen. So weit, so gravierend. Doch dann ist da noch diese Verächtlichkeit, mit der über die transatlantischen Partner gechattet wurde.
So schrieb US-Vizepräsident J.D. Vance, er sei es „einfach leid, die Europäer wieder herauszuhauen“. Dabei bezog er sich darauf, dass 40 Prozent des europäischen Handels durch den Suezkanal liefen, aber nur drei Prozent des US-amerikanischen. Er sei sich nicht sicher, ob der Präsident verstehe, dass Luftschläge gegen die Huthi seine Druckversuche gegen Europa abschwächten, so Vance weiter. Verteidigungsminister Pete Hegseth versicherte dem Vizepräsidenten daraufhin: „Ich teile deine Verachtung für europäisches Trittbrettfahren. Es ist ERBÄRMLICH.“