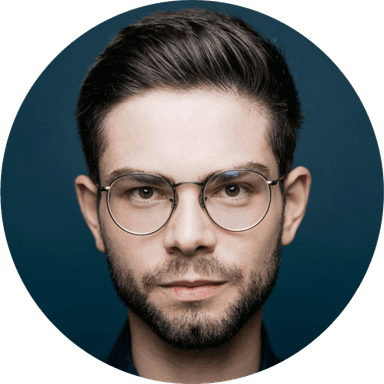Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerbenGuten Morgen. Gestern war ein wichtiger Tag für die deutsche Raumfahrt. Das Münchner Start-up Isar Aerospace hat nach sieben Jahren Vorbereitungszeit von der norwegischen Insel Andøya aus völlig losgelöst seine erste Trägerrakete namens Spectrum gestartet.
Der Testflug dauerte zwar nur rund 30 Sekunden, bevor die Rakete ins Meer stürzte. Doch trotzdem konnten durch den Start viele wichtige Daten gesammelt werden – genau das war das Ziel. Es handelte sich um den ersten Start einer Orbitalrakete in Kontinentaleuropa außerhalb Russlands und den ersten Start einer privaten Weltraumrakete aus Deutschland. „Der ungehinderte Zugang zum Weltraum ist strategisch entscheidend – nur wer ins All gelangt, kann es auch nutzen“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Am Ende geht es auch hier um die wirtschaftliche und technologische Souveränität. Um die Frage, wie Deutschland und Europa selbstständig und unabhängig Satelliten ins Weltall befördern können. „Dieser Tag markiert einen Meilenstein für unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Raumfahrt und ist ein Beweis für unternehmerischen Mut Made in Germany“, sagte Habeck.
Willkommen am Platz der Republik.
Was wichtig wird
Heute gehen die schwarz-roten Koalitionsgespräche in der 19-köpfigen Verhandlungsgruppe nach einem Tag Pause weiter. Am Samstagnachmittag war CSU-Verhandler Alexander Dobrindt vor die Presse getreten: „Wir sind vorangekommen, aber wissen, dass wir Dinge auflösen müssen“, sagte er. Deshalb wird es heute noch kleinere „Problemlösungsrunden“ geben, bevor am Abend wieder in der großen Gruppe verhandelt wird. Diesmal geht es ins Konrad-Adenauer-Haus.
Clearing-Phase: Am Freitag hatten Friedrich Merz, Markus Söder, Lars Klingbeil und Saskia Esken betont, dass man zunächst die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sortieren und über Finanzfragen sprechen wolle. Dabei hatte die Runde auch die Papiere der AGs relativiert: „Ich habe in der Tat das Gefühl, dass bei manchen Arbeitsgruppen – nicht bei allen –, die Überschrift lautet: Wünsch dir was“, sagte Merz. „Das wird jetzt unsere Aufgabe sein, das auf das mögliche Maß zu reduzieren.“
„Wir sind schon auf der Zielgeraden“, sagte SPD-Verhandlerin Anke Rehlinger in der ARD. Vertreterinnen und Vertreter von Schwarz und Rot bedauerten am Wochenende, dass die Ergebnispapiere der Arbeitsgruppen bekannt wurden. Der Tenor: Das hat die ohnehin schwierige Kompromissfindung nur noch schwieriger gemacht. Laut Bild könnten die Verhandelnden bis Freitag mit allen Arbeitsgruppen durch sein: Die drei Sprecherinnen und Sprecher sollen jeweils vorgeladen werden, bevor es in die Debatte geht.
Der größte Brocken: Die Finanzen. Rehlinger mahnte ihrerseits eine steuerliche Entlastung für die überwiegende Zahl der Bürgerinnen und Bürger an, verwies aber darauf, dass starke Schultern eine höhere Last tragen sollten. „Steuererhöhungen sind völlig ausgeschlossen“, stellte Söder gestern im Bericht aus Berlin klar. Steuern für Unternehmen und die Einkommenssteuer sollen vielmehr sinken – und der Soli ganz weg. Das Thema Haushalt und Steuern soll laut Bild heute auf der Tagesordnung stehen – diesmal ganz ohne Arbeitspapiere. Als weiterer großer Streitpunkt gilt der Umgang mit illegaler Migration.
Der Arbeitsauftrag: Es geht nun darum, eine große Linie für die Herausforderungen im Land zu finden, anstatt sich im Klein-Klein der Ergebnispapiere zu verlieren. „Wir werden das hinbekommen“, sagte Söder. Den schwersten Teil hätte man schon hinter sich, fügte er mit Verweis auf das Schuldenpaket hinzu. Mit Blick auf die nicht geeinten Punkte dürfte es aber noch dauern: Zuletzt hieß es immer öfter, dass man nicht mehr mit einer Vereidigung von Merz in der Woche nach Ostern rechne: Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit. Realistischer sei dagegen Anfang Mai, gehandelt wird etwa der 7. Mai.
In der Union bahnt sich eine Debatte um den Umgang mit Russland an. „Es ist wünschenswert, wenn es in der Union zu einer Aufarbeitung der verfehlten Russlandpolitik der Vergangenheit käme, denn wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen“, sagte CDU-Politiker Roderich Kiesewetter SZ Dossier. „Wer russische Narrative verbreitet oder wieder auf russisches Gas setzt, der schwächt damit europäische Sicherheit, die insbesondere Geschlossenheit und Stärke gegenüber Russland braucht.“
Was zuvor geschah: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat das kategorische Nein Deutschlands und anderer europäischer Länder zu einer Lockerung der Sanktionen gegen Moskau kritisiert: „Das ist völlig aus der Zeit gefallen und passt ja auch gar nicht zu dem, was die Amerikaner gerade machen“, sagte Kretschmer der dpa. Wie Kiesewetter betonte, wünsche er sich, dass sich „die klare Haltung der Mehrheit der Union für Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung und gegen ein Appeasement von Mördern und Kriegsverbrechern“ durchsetze.
Vorschlag für Koalitionsvertrag: „Eine Reaktivierung von Nord Stream sollte am besten im Koalitionsvertrag ausgeschlossen werden, damit sämtlichen Spekulationen und russlandfreundlichen Ambitionen der Wind aus den Segeln genommen wird“, sagte Kiesewetter. Mit Appeasement wie Sanktionslockerungen werde die deutsche Sicherheit geschwächt sowie der Aggressor und Terrorstaat Russland gestärkt.
Scharfe Kritik: Kritik für die Äußerung Kretschmers gab es auch aus anderen Parteien. „Während Putin weiter Bomben auf die Ukraine wirft, biedert sich Ministerpräsident Kretschmer dem Kriegstreiber wieder an“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann der dpa. Sie forderte Parteichef Friedrich Merz auf, die „Moskau-Connection“ in der CDU schnellstens abzuwickeln, und fügte hinzu, dass „Putin-Freunde“ in Koalitionsverhandlungen keine Rolle spielen dürften.
Kein Einzelfall: Kretschmer gehört zur 19er-Runde, die gerade verhandelt. Aufgefallen waren aber auch zwei Verhandler aus den Arbeitsgruppen: der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß und der Landespolitiker Jan Heinisch. Beide hatten während der laufenden Verhandlungen angedeutet, nach einem Frieden müsse auch wieder über russisches Gas nachgedacht werden. „Friedrich Merz und die Spitze der CDU können sich nicht länger wegducken und müssen zum Aufleben der Moskau-Connection endlich klar Stellung beziehen“, sagte Haßelmann.
Waren die verbliebenen Abgeordneten der Gruppe Die Linke im 20. Bundestag ein kleines Trüppchen, ergibt sich seit der konstituierenden Sitzung des Bundestages ein neues Bild: 64 Parlamentarierinnen und Parlamentarier bilden die neue Fraktion, 46 von ihnen sitzen zum ersten Mal im Bundestag. Bei einer dreitägigen Klausur in Potsdam hat sich die neue Fraktion nun genauer kennengelernt und inhaltlich neu aufgestellt. Die Fraktionsspitze um Sören Pellmann und Heidi Reichinnek stellte gemeinsam mit dem Partei-Führungsduo Iris Schwerdtner und Jan van Aken am Freitag ein 100-Tage-Programm vor. Elena Müller berichtet.
Der Fokus: Wie auch schon im Wahlkampf sind die Mieten der Kern der „Politik der sozialen Gerechtigkeit“. Zudem will die Linke die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen, den Kita-Notstand adressieren, eine Aktionskonferenz zur Steuergerechtigkeit organisieren und sich für die Abschaffung des Paragrafen 218 einsetzen. Die Fraktion will zudem die Schuldenbremse loswerden oder „zumindest grundlegend“ reformieren. „Die ausgesetzte Vermögensteuer muss wieder erhoben werden. Nur so können die dringend nötigen Investitionen in die Bereiche, die für uns alle wichtig zum Leben sind, getätigt werden“, heißt es im Programm.
Der Union die Hand reichen: Als einen der ersten Schritte wolle man einen Antrag gegen Mietwucher in den Bundestag einbringen. „Wir gehen bei diesem Antrag davon aus, dass wir die freundliche Unterstützung von Markus Söder aus Bayern haben, denn er hat eine solche Initiative bereits zweimal über den Bundesrat eingebracht“, berichtet Reichinnek. „Wohnen ist und bleibt eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit.“ Vor der Sommerpause soll es zudem einen Mietengipfel geben.
Die Brandmauer: Nicht nur die Linksfraktion ist gewachsen – am anderen Ende des Plenarsaals sitzt auch die AfD mit mehr Abgeordneten als je zuvor. Ihre Zahl hat sich von 83 auf 152 Sitze fast verdoppelt. Hier sieht sich die Linke als die Brandmauer: „Wir sind ein Garant im Kampf gegen rechts“, sagte Pellmann in Potsdam. „Es ist klar, dass wir dagegenhalten“, ergänzte Reichinnek. Für die Linke gelte weiterhin, dass man eine Partei wie die AfD vor allen Dingen mit einer starken Sozialpolitik bekämpfe. Man wolle eine Gegenmacht bilden zum Populismus und zum Hass und der Hetze, „die uns jetzt von der rechten Seite natürlich doppelt so laut entgegenschallen wird.“
Durch die Kürzungen der US-Administration stehen auch Stipendiatinnen und Stipendiaten des Fulbright-Programms vor Herausforderungen. Das Programm fördert den akademischen Austausch mit den Vereinigten Staaten und wird teilweise vom amerikanischen Außenministerium finanziert. Durch eine vorübergehende Aussetzung der Finanzierung von mehreren Stipendienprogrammen hakt es jedoch seit Wochen. Die Stipendiaten befürchten sogar ein Ende des seit 1952 bestehenden Programms.
Harte Einsparungen: Wie eine Stipendiatin berichtet, die derzeit nach Abschluss ihres Studiums in den USA arbeitet, seien die meisten Administratoren von Fulbright, also Mitarbeitende der Organisation IIE, in den USA beurlaubt worden. Darüber seien die Stipendiatinnen und Stipendiaten am 14. März per Mail informiert worden. Die Nachricht liegt SZ Dossier vor. „Aufgrund von Verzögerungen bei der Auszahlung von Mitteln des Außenministeriums haben wir vorübergehend die Zahl der Mitarbeiter der IIE reduziert, halten aber die wesentlichen Tätigkeiten aufrecht“, heißt es.
Bestehende Einschränkungen: In der Praxis bedeutet das laut der Stipendiatin, dass Fulbrightern zunächst mitgeteilt wurde, dass sie ihr Visum nicht erneuern oder verlängern können. Auch wenn hier die Regelung revidiert wurde, bleibe große Ungewissheit aufgrund des weiterhin wackelnden Fundings des US-Außenministeriums. Man benötige zudem auch immer eine Genehmigung, wenn man etwa auf dem Uni-Campus arbeiten – oder nach dem Abschluss noch ein Praktikum anhängen wolle. Vor allem ein Nebenjob ist wegen der hohen Studiengebühren, die auch das Stipendium nicht vollständig abdecken kann, eher die Regel.
Auch das war zunächst eingestellt worden. Seit dem Wochenende kann man die Administration wieder kontaktieren, heißt es auf einer offiziellen FAQ-Seite. Die Beantragung eines Praktikums oder Jobs nach dem Studium ist hingegen weiterhin nicht möglich. Auch Auslandsreisen seien wegen der Visasituation nicht mehr sicher: „Bitte beachten Sie, dass internationale Reisen mit Risiken verbunden sind, auch wenn Sie ein gültiges Visum für die mehrfache Einreise haben“, heißt es auf der FAQ-Seite. So oder so fühlten sich derzeit viele verunsichert, berichtet die Stipendiatin, die seit Längerem den Austausch in entsprechenden Chatgruppen verfolgt.
Auf dem Prüfstand: Das Fulbright-Programm für Deutschland wird aus deutschen Mitteln bezahlt. Deshalb macht sich die Stipendiatin zunächst keine Sorgen über die Mittel für deutsche Studierende vor Ort. Sie befürchtet aber, dass Präsident Trump das Programm ganz abschaffen könnte. Hinzu kommt: Die Einsparungen im US-Programm würden vor allem Studierende aus dem Globalen Süden treffen, die oftmals keine Mittel aus ihren Herkunftsländern beziehen. Die Möglichkeit, in den USA zu studieren, würde ihnen dadurch möglicherweise genommen. Gelder wurden wegen der vorübergehenden Aussetzung bereits verspätet ausgezahlt. Derzeit gilt das Programm als „auf dem Prüfstand“.
Tiefgang
Zuletzt wurde in Berlin Tempo gemacht. Zuerst ging es bei den Sondierungsverhandlungen, dann bei der Grundgesetzänderung Schlag auf Schlag. In der vergangenen Woche hat sich der neue Bundestag konstituiert und die Koalitionsverhandlungen nehmen ihren Gang. Es ist aber bereits absehbar, dass es länger dauern wird, als es sich die beiden künftigen Regierungsparteien vorgenommen haben. Ob, wie vom Kanzler in spe Friedrich Merz gewünscht, bis Ostern eine neue Regierung steht, ist nicht klar.
Aber auch ohne Exekutive ist der Bundestag arbeitsfähig – theoretisch. Denn ohne Ausschüsse können keine gesetzgeberischen Entscheidungen getroffen werden. Doch meistens wird mit der Einsetzung der Fachgremien gewartet, bis die Regierung die Ressorts und Ministerposten verteilt hat. Denn am Zuschnitt der Ministerien bildet sich ab, welche Ausschüsse welche Themen federführend bearbeiten werden. Zudem gehören Mitglieder der Regierung in der Regel keinen Ausschüssen an.
Was aber, wenn dringend Entscheidungen getroffen werden müssen oder sich die Regierungsbildung ungewöhnlich lange hinzieht? Damit der Bundestag nicht gelähmt bleibt, kann der Hauptausschuss eingesetzt werden, in dem alle Themen bearbeitet werden können. Dies ist zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik im Jahr 2013 geschehen, damals verhandelte ebenfalls Schwarz-Rot.
Dem Gremium gehörten damals 23 Abgeordnete aus der Union und 14 aus der SPD an, Grüne und Linke stellten jeweils fünf Mitglieder. Vorsitzender war Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU). Rund vier Wochen später wurde der Hauptausschuss mit der Konstituierung von 22 ständigen Ausschüssen aufgelöst. Auch nach den Bundestagswahlen 2017 und 2021 wurde ein Hauptausschuss eingesetzt.
Aus Unionskreisen heißt es auf Nachfrage, es sei gerade „alles im Fluss“. Aufgrund der laufenden Koalitionsverhandlungen sei noch nicht absehbar, ob der Hauptausschuss eingesetzt werden muss oder nicht. Klar scheint bereits zu sein, dass die im Kalender der Bundestagsverwaltung angesetzte Sitzungswoche vom 7. bis 11. April nicht stattfinden wird. Davon geht man zumindest in der Union aus. Die Entscheidung über die Tagesordnung trifft der Ältestenrat, der sich noch nicht gebildet hat.
Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Christian Görke, sieht das anders: „Wir können natürlich unverzüglich zu einer Sitzungswoche zusammenkommen. Unser Auftrag ist es, aktuelle Themen – und davon gibt es reichlich – zu beraten sowie Anträge zu beschließen. Gleichzeitig bedarf es einer Regierungsbefragung, um die Kontrolle der amtierenden Regierung sicherzustellen.“ Er sehe nicht, dass nach den eiligen Entscheidungen zum Grundgesetz jetzt eine „parlamentarische Schleichfahrt stattfinden sollte“, sagte Görke SZ Dossier. „Wir erwarten, dass der Deutsche Bundestag jetzt in die Puschen kommt.“
Die Linksfraktion fordert, dass nicht der Hauptausschuss, sondern stattdessen jene Ausschüsse – die das Grundgesetz vorsieht und seit der dritten Legislaturperiode unverändert geblieben sind – sofort eingesetzt werden. Das wären der Geschäftsordnungs-, der Petitionsausschuss, der Haushalts-, Finanz-, der Verteidigungs-, der EU- und der Auswärtige Ausschuss.
Der Bundestag dürfe nicht als bloßes Anhängsel der Regierung gesehen werden und müsse unverzüglich in die Facharbeit kommen, forderte Görke. „Noch vor zwei Wochen gab es so viel akute Dringlichkeit, das Grundgesetz zu ändern und jetzt will man sich Zeit lassen.“ Es gebe ein funktionierendes Bundestagspräsidium und auch sonst keinen Grund, warum der Bundestag mit seiner Arbeit weiter warten solle. Elena Müller
Fast übersehen
Hagel tritt gegen Özdemir an. Was sich so mancher politische Beobachter schon länger gedacht hat, steht nun fest: Manuel Hagel geht als CDU-Spitzenkandidat in die baden-württembergische Landtagswahl im März 2026. Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion will der nächste Ministerpräsident werden. „Wir werden nicht alles anders, aber vieles ambitionierter machen“, sagte Hagel der SZ. Dass er am 17. Mai von einem Parteitag bestätigt wird, gilt als Formalie. Die Ausgangslage könnte kaum besser sein, schreiben Max Ferstl und Roland Muschel in der SZ. Bei der Bundestagswahl hat die CDU in Baden-Württemberg 31,6 Prozent geholt – und damit das beste Ergebnis aller Landesverbände.
Le Pen vor Gericht: Die Präsidentschaftskandidatur von Marine Le Pen ist in Gefahr. Das Gesicht des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) und ihre Partei sollen EU-Gelder in Millionenhöhe veruntreut haben und stehen deshalb vor Gericht. Heute wird das Urteil verkündet. Laut Ermittlungen der Anti-Betrugsbehörde der EU sollen Parlamentsassistenten von Le Pens Partei zu Unrecht mit EU-Geldern bezahlt worden sein. Oliver Meiler hat hier alle Details.
Der Vorwurf: Sie hätten nicht für EU-Parlamentarier gearbeitet, sondern für den Parteiapparat und die Familie Le Pen. Die Pariser Staatsanwaltschaft fordert für Le Pen deshalb eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren – drei davon auf Bewährung – und 300.000 Euro Bußgeld. Zudem will sie Le Pen für fünf Jahre und mit direkter Wirksamkeit das passive Wahlrecht entziehen. Le Pen, die derzeit als Favoritin gilt, könnte also nicht bei der französischen Präsidentschaftswahl 2027 antreten, da ein Berufungsprozess wohl länger dauern würde. Ein solcher Prozess hätte keine aufschiebende Wirkung.
Blick nach Syrien: Nachdem der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa eine neue Regierung ernannt hat, äußerte sich Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) verhalten optimistisch. „Nach 14 Jahren Bürgerkrieg hat Syrien die Chance auf einen Neuanfang. Für einen erfolgreichen Neuanfang kommt es darauf an, dass sich die Lebensbedingungen für alle Bevölkerungsgruppen in Syrien in den nächsten Monaten spürbar verbessern“, sagte Schulze.
Potenzial für Kooperation: „Wie eng Deutschland und Syrien miteinander verbunden sind, zeigt auch die Ernennung des neuen Gesundheitsministers und des neuen Bildungsministers, die beide in Deutschland gelebt haben“, sagte Schulze. Neuer Gesundheitsminister wird Musab al-Ali, Oberarzt für Neurochirurgie am städtischen Klinikum Solingen. Der neue Bildungsminister Mohamed Abdulrahman Turko hat in Leipzig studiert, die neue Sozialministerin Hind Kabawat eng mit dem BMZ zu Frauenrechten gearbeitet.
Unter eins
SPD-Chef Lars Klingbeil bei Caren Miosga über sein Verhältnis zu Friedrich Merz
Zu guter Letzt
Mit rasenden Politikern ist es so eine Sache: Die Fälle werden meistens bekannt, weil die Geblitzten das Bußgeld nicht zahlen wollen und die Ordnungswidrigkeit dann vor den Amtsgerichten dieser Republik landen. So geschehen auch bei CDU-Mann Philipp Amthor, der seinen Führerschein vor einigen Jahren für einen Monat abgeben musste.
„Natürlich reklamiere ich dabei keine Sonderrechte auf zu schnelles Autofahren, aber es ist auch nicht unanständig, einen Bußgeldbescheid gerichtlich überprüfen zu lassen“, sagte er damals. Amthor war 2020 mit rund 120 Kilometern pro Stunde auf einer Straße mit Höchstgeschwindigkeit 70 unterwegs. Der aktuelle sächsische Kultusminister Conrad Clemens (CDU) war 2023 mit Tempo 80 in einer 30er-Zone geblitzt worden. Auch er legte Widerspruch ein, zog diesen dann aber zurück.
Einen schnelleren Weg hat Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet gewählt: Nicht nur war er in der Aachener Innenstadt mit 97 Kilometern pro Stunde unterwegs, er meldete sich tags darauf auch direkt bei der Polizei. Laschet, der gerade als Minister gehandelt wird, habe an einer Ampel Vollgas gegeben, sagte er der Bild, weil er von einem Wagen dicht verfolgt worden sei und sich bedroht gefühlt habe. Auch er legte deshalb Widerspruch ein, im Mai sollte es ein Verfahren am Amtsgericht geben. Doch: Nachdem die Staatsanwaltschaft die Verfolger nicht ermitteln konnte, zog auch Laschet den Einspruch zurück. Sein Führerschein ist einen Monat lang weg.
In der Ausgabe vom Freitag waren falsche Angaben zu der Höhe von Zöllen auf Importe von Pickups und Nutzfahrzeugen aus den USA in die EU enthalten. Korrekt ist: Die USA erheben Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe von Pickups und Nutzfahrzeugen aus Europa. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler.