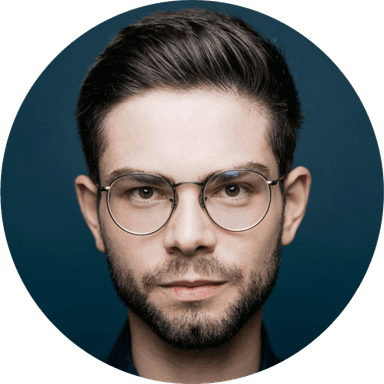Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerben
Es rumort in der Union
Donnerstag, 3. April 2025Guten Morgen. Wie erwartet hat US-Präsident Donald Trump ein weitreichendes Zollpaket auf den Weg gebracht. Es ist ein System wechselseitiger Zölle „für Länder in der ganzen Welt“, wie er im Rosengarten des Weißen Hauses ankündigte. Dort unterzeichnete er nach seiner Rede ein entsprechendes Dekret.
Trump führte aus, das „goldene Zeitalter“ der USA komme nun wieder. Sein Kalkül: US-Unternehmen sollen keine Produkte mehr aus dem Ausland einführen, das soll langfristig den Produktionsstandort USA fördern. Die sich anbahnenden Handelskonflikte dürften derweil Verbraucherinnen und Verbraucher belasten.
Heute stehen die internationalen Reaktionen auf den amerikanischen „Tag der Befreiung“ im Mittelpunkt. Auf EU-Importe werden künftig Zölle in Höhe von 20 Prozent erhoben, wie auf einer Tafel zu sehen war, die Trump in die Kameras hielt. Offizielles Ziel in Brüssel sei zwar eine Verhandlungslösung, hieß es schon in den vergangenen Tagen und Wochen, man habe aber einen Plan in der Schublade, um europäische Interessen zu schützen.
Trump wird wohl bilaterale Lösungen anbieten, dafür aber auch Gegenleistungen fordern. Unser Dossier Geoökonomie ordnet die Entwicklungen wie immer um 21:30 Uhr ein. Wenn Sie ein Probeabo abschließen, sind Sie schon heute Abend bestens informiert.
Willkommen am Platz der Republik.
Was wichtig wird
Klar, es ist Markus Söder. Aber drastischer hätte man es nicht ausdrücken können. Mit Blick auf die Verantwortung der nächsten Bundesregierung sagte der CSU-Chef kurz nach der Wahl. „Dies ist tatsächlich die letzte Patrone der Demokratie.“ Nun ist die Regierung zwar noch nicht im Amt, aber so manch einer befürchtet schon, der Schuss könnte daneben gehen.
Was auf dem Spiel steht: Am Dienstag hat eine Forsa-Umfrage den Verhandlerinnen und Verhandlern der Union den Ernst der Lage vor Augen geführt: Die Demoskopen sahen CDU und CSU bei 25, die AfD bei 24 Prozent. Die nächste Bundestagswahl, die Söder mit seinem Ausspruch im Blick hat, ist zwar noch weit, weit entfernt. Näher sind da schon die Landtagswahlen im kommenden Jahr, unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Martin Reichardt, Landesvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, hat das Ziel seiner Partei bereits formuliert: Alle Direktmandate gewinnen, 45 Prozent holen und den Ministerpräsidenten stellen. Das sagte er in der Eröffnungsrede des Landesparteitags Anfang März.
Die Herausforderung: Bei der Bundestagswahl holte die AfD in Sachsen-Anhalt 37,1 Prozent der Zweitstimmen und 38,8 Prozent der Erststimmen. Und momentan findet sie bei ihrem selbst ernannten Hauptgegner, der Union, besonders viel Angriffsfläche vor. Innerhalb der Partei sieht man die Sache so: Die hohen Summen aus dem Finanzpaket machten den „Leuten regelrecht Angst“, sagte Schatzmeister Carsten Hütter.
Leichtes Spiel: Angst ist ein Gefühl, das die AfD gerne bewirtschaftet. Hinzu kommt: Durch Merz‘ Kurswechsel in Sachen Schuldenbremse und Sondervermögen kann die Partei weiter daran arbeiten, die Union zu delegitimieren, indem sie ihr Wortbruch vorwirft. So sagte Alice Weidel in der Bundestagsdebatte über die Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse zum Beispiel: Wer CDU wähle, bekomme „links-grüne Politik präsentiert“. Die in Teilen rechtsextreme Partei muss also selbst gar nicht viel tun – und befindet sich trotzdem in einer komfortablen Situation. Er rechne damit, sagte Hütter, dass sich nun ehemalige Mitglieder der CDU bei der AfD meldeten.
Dilemma: Wie misslich die Lage für die Union (und die SPD) ist, zeigt sich, wenn man die Sache einmal umdreht. Denn was ist die Alternative? Verbunden mit der teilweisen Aussetzung der Schuldenbremse und dem Sondervermögen ist ja die Hoffnung, die Wirtschaft anzukurbeln, die Infrastruktur zu modernisieren und so den Untergangspropheten den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Es fehlt ein Ausweg: Außerdem kann die Union die SPD in den Verhandlungen nur bedingt unter Druck setzen. Ihr fehlen schlicht die Optionen. Vor allem aber das Schuldenpaket löste an der Basis Unmut aus: In Kühlungsborn verließ ein Drittel des Stadtverbands die CDU. Wegen der Grundgesetzänderungen sei die politische DNA der Partei in Gefahr, hieß es dort. In Gesprächen mit CDU-Mitgliedern aus ostdeutschen Landesverbänden reicht die Beschreibung der Stimmungslage von „angespannt“ bis „schwierig“. Die Posteingänge von Landtagsabgeordneten seien voll, insbesondere die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer enttäuscht.
Ärger über Kommunikation: Einen Grund für die Unzufriedenheit sieht so mancher auch in den Medienberichten über die Papiere der Arbeitsgruppen und in den Leaks. Schließlich seien die Koalitionsverhandlungen noch nicht beendet, man bewerte aber bereits die Zwischenergebnisse. „Die Unkenrufe schon vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen bringen niemanden weiter, am wenigsten das Land“, sagte Gitta Connemann dem Handelsblatt. Die Kommunikation im und nach dem Wahlkampf sei nicht ideal gewesen, da sie schnelle Lösungen suggeriert habe, heißt es in ostdeutschen Landesverbänden. Trotzdem gehe es jetzt darum, erst einmal das Ergebnis der Verhandlungen abzuwarten. Die Erwartungen, gerade was die Migrations- und Sparpolitik angeht, sind hoch.
Es geht zwar voran bei den Koalitionsverhandlungen, aber nach einer Einigung in dieser Woche sieht es nicht aus. Sie sei überzeugt, sagte SPD-Chefin Saskia Esken vor der gestrigen Runde der Gespräche, „dass wir in die nächste Woche gehen werden“. Es sei noch viel zu tun. Verhandelt wird jetzt auch in Dreiergruppen zu verschiedenen Themen wie Gesundheit, Energie, Digitales oder Verkehr. Die Untergruppen speisen sich aus der 19-köpfigen Verhandlungsgruppe.
Knackpunkt Finanzen: Es werde noch immer darüber gesprochen, wo man realistisch sparen könne, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. „Für uns ist entscheidend, dass Einsparpotenziale realisiert werden.“ Man stelle aber Bewegung fest. Zeitdruck wollte auch der CSU-Politiker nicht erzeugen. Es solle kein Dissens aufkommen, „der ungelöst ist und später Schwierigkeiten bereitet“, sagte Dobrindt.
Nachwuchs stellt Stopp-Schilder auf: „Keine Koalition zu jedem Preis“, heißt es derweil vom Parteinachwuchs der SPD, den Jusos. Sie haben in sozialen Medien eine Liste mit Punkten veröffentlicht, die ihrer Ansicht nach gar nicht gehen. Unter anderem pochen sie darauf, dass es keinen Entzug der Staatsbürgerschaft gibt, keine Leistungskürzungen für Asylbewerber und keine Abweisungen an deutschen Grenzen. Auch der Acht-Stunden-Tag soll bleiben. Eine Wehrpflicht soll es ebenso nicht geben wie Schikanen im Sozialstaat.
Mein Ministerium soll bleiben: Bleiben soll nach Ansicht der Jusos auch das Entwicklungsministerium. Damit sind sie auf einer Linie mit der Hausherrin. Svenja Schulze sagte gestern, sie würde das Ministerium gerne erhalten. Und sie sei auch „sehr, sehr gerne Entwicklungsministerin“. All das verschafft den Verhandlerinnen und Verhandlern auf sozialdemokratischer Sicht nicht gerade Beinfreiheit – vor allem vor dem Hintergrund, dass am Ende noch ein Mitgliedervotum folgt.
Auch die Wirtschaft stellt Forderungen: Während sich die Verhandlerinnen und Verhandler über die Details beugen, kommt von gut 100 Verbänden die Forderung, mehr für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zu tun. Die bisherigen Ergebnisse bezeichnen die Lobbyisten in einer gemeinsamen Erklärung als „unzureichend“. Sie fordern eine deutliche Steuerentlastung für Unternehmen und Betriebe. Außerdem sollten die sozialen Sicherungssysteme „dringend reformiert“, die Bürokratie abgebaut und die Energiepreise gesenkt werden.
Die neuen Zahlen weisen erneut einen Anstieg der Gewaltkriminalität aus: Besonders unter Kindern gab es mehr Fälle. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat gestern die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vorgestellt. Insgesamt gab es dank der Teillegalisierung von Cannabis mit 5,8 Millionen weniger Straftaten als im Vorjahr. Doch bei den Zahlen sollte trotzdem genau hingeschaut werden. Drei Erkenntnisse.
Besonders die Gewaltdelikte sind gestiegen. Die Polizei zählte insgesamt 217 000 Straftaten in diesem Bereich und damit so viele wie seit 2010 nicht mehr. „Jeden Tag kommt es in Deutschland zu 600 Gewaltdelikten“, sagte Faeser. Die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzungen stieg seit 2010 um fast elf Prozent, berichtet Markus Balser in der SZ. Verzeichnet wurden auch Daten zu Messerangriffen: Demnach kam es zu 15 000 von ihnen, mehr als sieben Prozent aller Gewaltverbrechen.
Immer häufiger werden Minderjährige zu Tätern. Laut der Statistik stieg die Zahl der Verdächtigen bei bis zu 14-jährigen Kindern innerhalb eines Jahres um mehr als elf und bei Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren um vier Prozent. BKA-Chef Holger Münch sieht die wichtigste Erklärung hierfür im Anstieg psychischer Belastungen, ausgelöst vor allem durch die Corona-Pandemie. Das BKA forderte von der Politik, sich stärker um die Heranwachsenden zu kümmern, die sonst auch als Erwachsene zur echten „Problemgruppe“ werden könnten.
Die Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Bei den Opfern von Gewalt wächst die Zahl der Frauen deutlich. Die Zahl angezeigter schwerer Gewalttaten wie etwa Vergewaltigungen, sexueller Übergriffe und sexueller Nötigung stiegen um mehr als neun Prozent auf 13 320 Fälle. Die Opfer waren nahezu ausschließlich weiblich. Wie Faeser betonte, sei ein besserer Schutz von und mehr Hilfe für Frauen nötig. „Keine Frau muss sich dafür schämen, Opfer von Gewalt geworden zu sein“, sagte die Innenministerin.
Tiefgang
Der Digital Services Act (DSA) ist nicht zuletzt dank Tech-Milliardär Elon Musk und US-Vizepräsident J.D. Vance weltberühmt geworden. Musk und Vance stellen ihren Gefolgsleuten die Verordnung gern als Zensurinstrument der EU-Kommission vor: Europa solle sich ein Beispiel an den USA nehmen, wo es noch das Recht auf freie Meinungsäußerung gebe. Doch an der Stelle wird der DSA vermutlich vorsätzlich missverstanden – wobei das Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit und Plattformregulierung tatsächlich heikel sein kann. Daniel Holznagel, Richter und Experte für Plattformregulierung, hat mit SZ Dossier über die Unwegsamkeit des Gebiets gesprochen.
„Mitunter wird formuliert, der DSA zwinge dazu, Desinformation und Fake News zu beseitigen oder er könnte dazu eingesetzt werden“, sagte Holznagel. Tatsächlich sei dem nicht so, sondern vielmehr stelle der DSA Sorgfaltsanforderungen struktureller Art auf, die sich mittelbar auswirken können. „Zum Beispiel die Vorgabe, dass Plattformen achtgeben müssen, dass Algorithmen nicht durch unauthentische Nutzung manipuliert werden.“ Das könne mittelbar dazu führen, dass die Effektivität von Desinformationskampagnen zurückgeht. „Es ist kein Zensurinstrument, erst recht kein politisches.“
Dennoch habe Vance einen Punkt, auch wenn er vieles verzerrt darstelle. „Zum Beispiel, dass die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung wegen einer Beleidigung macht, das kann bei uns ja vorkommen“, sagte Holznagel. „Das gäbe es in den USA nicht, obgleich es dort natürlich ganz andere Sachen gibt, die unverhältnismäßig erscheinen.“ Es sei aber unstrittig, dass das Äußerungsstrafrecht hierzulande strenger ist als in den USA. „Allerdings macht Vance daraus den Spin, dass es bei uns um die Unterdrückung politischer Meinungen ginge – das ist meines Erachtens nicht der Fall.“
Meinung, Lüge, Verleumdung – die Debatte kommt nicht zur Ruhe. „Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt“, schrieben etwa die Verhandelnden von Union und SPD der Arbeitsgruppe „Kultur und Medien“ vergangene Woche in ihr Papier (SZ Dossier berichtete). Ein anderer umstrittener Bereich von Äußerung und Ahndung sind Beleidigungen, wie sie etwa in den Fällen von Renate Künast und Robert Habeck für lautes Medienecho gesorgt haben.
Der Beleidigungstatbestand sei „relativ unbestimmt und weit“, sagte Holznagel. Man könne überlegen, ob nicht einfache Beleidigungen zum Beispiel zu einer Ordnungswidrigkeit abgestuft werden sollen. Im Plattform-Kontext sei es aber „verharmlosend, Hate-Speech-Phänomene anhand einfacher Beleidigungen zu diskutieren.“ Das habe mit der traditionellen Beleidigung gar nichts zu tun: „Es geht um anonyme Bedrohungskampagnen und Mob-Dynamiken, Stalking, Nachstellen, Verleumdungen, und so weiter.“
Ähnlich wie das deutsche Strafrecht ist auch der DSA nicht unveränderlich und könnte verbessert werden: „Die ersten Evaluierungen stehen schon 2025 an und dann abschließend 2027 die erste Runde“, sagte Holznagel. Da hätten die EU-Mitgliedstaaten einen großen Hebel. „Gerade so einflussreiche Länder wie Deutschland durch Stellungnahmen und Abfragen der Stakeholder und mehr.“ Aus Holznagels Sicht sollte beim DSA und auch bei anderen Digitalgesetzen dabei auf „Verschlankung und Entbürokratisierung“ hingewirkt werden.
Neben solchen Fragen gebe es auch den Bedarf für ein „modernes Zustellungsrecht auf EU-Ebene“, sagte Holznagel. Die wachsende Bedeutung der Plattformen führe dazu, dass auch die gerichtliche Klärung von Streitigkeiten in diesem Verhältnis immer wichtiger wird. Die Klärung setze aber voraus, dass man erstmal ein Verfahren eröffnen kann. Das wiederum setze die förmliche Übermittlung der verfahrenseinleitenden Dokumente voraus. „Und das ist tatsächlich nicht mehr zeitgemäß im Jahr 2025 – es ist grundsätzlich noch per Post erforderlich oder im Ausland mit einem Umweg über die Behörden im jeweiligen Sitz-Land.“
Ziel müsse ein einheitlicher europäischer Rechtsstaat sein, wo gerichtliche Klärungen funktionieren. „Also brauchen wir ein modernes Zustellungsrecht, das natürlich digital funktioniert“, sagte Holznagel. Es sei „mysteriös“, dass keinen politischen Willen für eine richtige „große Lösung“ gebe. „Alle Praktikerinnen werden Ihnen sagen, dass das auf jeden Fall verbessert werden muss.“ Das müsse nicht „furchtbar viel Geld kosten“, gehöre aber auf die Agenda. „Das sollten die Koalitionäre meines Erachtens als europäischen Punkt aufnehmen, man braucht hier eine Lösung auf EU-Ebene.“
Ein weiterer wichtiger Punkt sei der Gerichtsstand: „Wenn ich es schaffe, gegen eine Plattform im Gerichtsverfahren einzuleiten, an welchem Gericht wird diese Klage dann verhandelt?“ Wer sich mit einer Plattform streite, müsse das oft an deren Sitz klären, „also vielleicht an einem irischen Gericht“, sagte Holznagel. „Üblicherweise muss ich einen Anwalt vor Ort haben, der sich dort auskennt.“ Wenn man aber überlege, ob es gerecht sei, dass man nach Irland gehen muss, obwohl die Plattform in Deutschland um Nutzerinnen und Nutzer wirbt, „käme man wahrscheinlich zu dem Ergebnis, dass es nicht gerecht ist.“ Laurenz Gehrke
Die Abonnentinnen und Abonnenten unseres Dossiers Digitalwende haben diesen Text in einer längeren Fassung zuerst gelesen.
Fast übersehen
Macht es Musk nicht mehr? Techmogul Elon Musk gibt einem Medienbericht zufolge seinen Posten als Berater von US-Präsident Donald Trump in Kürze auf. Aus dem Umfeld von Trump heißt es laut Politico, der US-Präsident sei nach wie vor zufrieden mit der Arbeit Musks, auch in der Bürokratieabbau-Behörde Doge (Department of Government Efficiency). Aber beide Männer hätten in den vergangenen Tagen beschlossen, dass es für Musk an der Zeit sei, zu seinen Unternehmen zurückzukehren und in der Politik eine Nebenrolle zu übernehmen.
Reaktion aus dem Weißen Haus: Regierungssprecherin Karoline Leavitt bezeichnete den Bericht auf X als „Müll“. Musk scheide erst dann aus dem Dienst aus, wenn seine Arbeit abgeschlossen sei. Die Berichterstattung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Trump-Vertraute bereits von Musks Unberechenbarkeit frustriert waren, den Milliardär zunehmend als politische Belastung betrachteten. Doch noch vor einem Monat hieß es unter Beamten im Weißen Haus, Musk sei „gekommen, um zu bleiben“ – auch über die von vorneherein angedachte 130-Tage-Frist seines politischen Engagements.
Also alles super: Trump hatte der US-Presse zuvor gesagt, dass „Elon irgendwann zu seinem Unternehmen zurückkehren will“ und fügte hinzu: „Er will es. Ich würde ihn so lange behalten, wie ich ihn behalten kann.“ Musk erklärte beim Sender Fox News seine Bürokratieabbaumission im Wesentlichen für erfüllt: „Ich denke, wir werden den größten Teil der Arbeit, die erforderlich ist, um das Defizit innerhalb dieses Zeitrahmens um eine Billion Dollar zu reduzieren, erledigt haben.“
Frauen gründen zu selten: Der Anteil von Frauen an Start-Up-Gründenden liegt einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge bei nur 19 Prozent und ist im vergangenen Jahr sogar leicht zurückgegangen. Wie der „Female Founders Monitor 2025“ des Start-up-Verbandes zeigt, stehen Frauen bei Gründungen weiterhin vor strukturellen Barrieren wie fehlenden Vorbildern oder einem in diesem Bereich unzureichenden Bildungssystem.
Unterschätzte Ressource: „Frauen sind die größte stille Reserve unseres Landes – wir können es uns nicht leisten, ihr Gründungspotenzial weiter zu verschenken“, sagte die Vorstandsvorsitzende des Start-up-Verbandes, Verena Pausder, SZ Dossier. Als Gründerinnen stießen sie jedoch auf zu große Hürden: Finanzierung sei schwerer zu bekommen, Netzwerke fehlten, und die Balance zwischen Familie und Unternehmertum bleibe eine Herausforderung.
Fachkräfte fördern: Die Verhandlerinnen und Verhandler von Union und SPD haben das Thema Frauen als Fachkräfte auf dem Schirm. Gleich am Anfang des Ergebnispapiers der AG Arbeit und Soziales steht die Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (SZ Dossier berichtete).
Unter eins
SPD-Entwicklungsministerin Svenja Schulze beim Weltgipfel für Menschen mit Behinderung in Berlin
Zu guter Letzt
Es herrscht mal wieder Streit um die Atomkraft. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat vor erheblichen Risiken gewarnt, sprach von einer „abwegigen Idee“. Der Hintergrund: Offenbar erwägt die Unionsfraktion trotz des laufenden Rückbaus der sechs stillgelegten Kernkraftwerke in Deutschland einen Kurswechsel, wie das Handelsblatt berichtete.
Laut eines Positionspapiers soll demnach geprüft werden, ob sich einzelne Anlagen, bei denen der Rückbau noch nicht weit fortgeschritten ist, wieder hochfahren ließen. Notfalls solle sie dafür auch der Staat übernehmen. „Die Vorstellung, dass der Bund als Eigentümer alter Atomkraftwerke auftreten und sämtliche Risiken schultern soll – ökonomisch, rechtlich und sicherheitstechnisch –, ist geradezu irrwitzig“, sagte Lemke daraufhin dem Spiegel.
Ihr Ministerium soll prompt eine interne Analyse aufgesetzt haben. Das Ergebnis: Essenzielle Komponenten seien in vielen Anlagen bereits ausgebaut oder dauerhaft unbrauchbar gemacht worden: Teilweise müssten ganze Systeme neu installiert werden. Die Gesetzeslage sehe zudem vor, dass stillgelegte Reaktoren umgehend rückgebaut werden müssen. Hinzu kommt: Auch wirtschaftlich ist die Forderung recht abenteuerlich, da die Rückbauplanungen längst beauftragt sind.