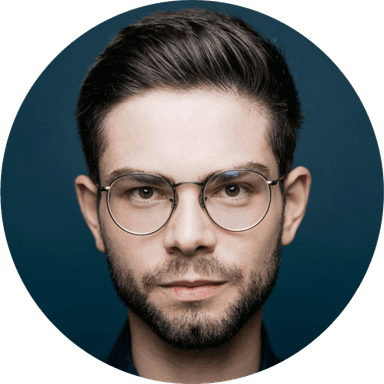Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerben
Europas Keule gegen die USA
Dienstag, 8. April 2025Guten Morgen. Der weltweite Absturz der Aktienkurse hat auch unmittelbare Konsequenzen auf die schwarz-roten Koalitionsverhandlungen gehabt. Gestern trafen die Verhandler Friedrich Merz, Markus Söder, Lars Klingbeil und Saskia Esken Bundeskanzler Olaf Scholz, um sich gemeinsam abzustimmen – die Verhandlungen wurden für das Gespräch unterbrochen. Es sei wichtig für die Exportnation Deutschland, dass man mit Europa eng zusammen agiere, hieß es gestern.
Derweil setzt die Union auf eine Wirtschaftswende. „Die Lage an den internationalen Aktien- und Anleihemärkten ist dramatisch und droht sich weiter zuzuspitzen“, sagte Merz gestern Reuters. Der Absturz müsse auch Konsequenzen haben für die Koalitionsverhandlungen: Deutschland müsse so schnell wie möglich „seine internationale Wettbewerbsfähigkeit“ wiederherstellen. Die Verhandlungen wurden gestern fortgesetzt, immer mehr Stimmen drängen auf eine schnelle Einigung.
Willkommen am Platz der Republik.
Was wichtig wird
Die Nachrichten an der Börse befeuern die Nervosität in der Union weiter. Friedrich Merz forderte, nun müsse die Frage der Wettbewerbsfähigkeit im Zentrum der Koalitionsverhandlungen stehen. „Wir brauchen Steuersenkungen für Unternehmen und Bürger, einen spürbaren Rückbau der lähmenden Bürokratie, die Senkung der Energiepreise und eine Stabilisierung der Kosten für die sozialen Sicherungssysteme“, sagte er.
Deal or no deal? Aus Brüssel kam gestern die Reaktion auf Donald Trump. Die EU hat dem US-Präsidenten eine beidseitige Abschaffung aller Zölle auf Industriegüter vorgeschlagen. „Europa ist immer zu einem guten Geschäft bereit“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Trump lehnte derlei gestern Abend europäischer Zeit rundheraus ab. Nicht gänzlich unerwartet: Man sei aber auch bereit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, sagte von der Leyen. Noch diese Woche sollen sie konkretisiert werden.
Erste Vergeltungsmaßnahmen: Zuletzt hatte sich Elon Musk für eine transatlantische Freihandelszone ohne jegliche Zölle ausgesprochen. Von der Leyen sagte, vor allem das Thema Freihandel für Autos sei bereits mehrfach auf dem Tisch gewesen – allerdings ohne adäquate Antwort. Bald kommen sollen erste Vergeltungsmaßnahmen für die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte: Laut eines Reuters-Berichts plant die EU Gegenzölle von 25 Prozent auf zahlreiche US-Produkte.
Breite Produktpalette: Einige Abgaben sollen demnach ab dem 16. Mai erhoben werden, andere erst im Dezember. Die Produkte sind breit gefächert: etwa Diamanten, Eier, Zahnseide, Würstchen und Geflügel, später auch Mandeln und Sojabohnen. Bourbon, Wein und Milchprodukte wurden hingegen nach einer Drohung von Trump von der ursprünglichen Liste gestrichen. Endgültig stehen soll die Liste am Mittwoch.
Zurück ins Regierungsviertel. Aus Verhandlungskreisen wurden Stimmen nach mehr Tempo laut. „Jetzt müssen alle springen“, sagte etwa Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). „Wichtig ist, dass jetzt Verantwortung übernommen wird. Die Spielchen müssen aufhören“, sagte er. Seine saarländische Amtskollegin Anke Rehlinger (SPD) betonte, die Entwicklung mache umso deutlicher, dass man schnell zu Ende kommen müsse. Söder betonte, alle seien sich der Verantwortung bewusst. „Wir werden gute Ergebnisse bekommen“, sagte er.
Das weltweite Börsenbeben hat tausende Milliarden Dollar an Wert vernichtet – zumindest auf dem Papier. Inzwischen sind aber auch die Rohstoffpreise deutlich gefallen – ein klares Zeichen für die Furcht vor einer weltweiten Rezession. Es berichtet Peter Ehrlich. Der Crash-Höhepunkt war gestern Morgen, als der Aktienindex in Hongkong um über 13 Prozent fiel und der deutsche Dax mit einem Minus von zehn Prozent eröffnete. Nachmittags hatte sich das Minus in Frankfurt und anderen europäischen Börsen verringert, weil sich die US-Börsen nach dem Kursrutsch am Donnerstag und Freitag stabilisierten und zeitweise im Plus lagen.
Crash-Ursache: Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hat inzwischen viele der Kursgewinne seit seinem Wahlsieg eliminiert. Das könnte man als Korrektur von Überbewertungen durchgehen lassen. Geringere Börsenkurse drücken aber auch auf Investitionen und in Ländern wie den USA, wo Aktienfonds eine große Rolle bei der Altersversorgung spielen, auf den Konsum. Welche Art von Crash wir gerade sehen, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.
Crash-Historie: Am „schwarzen Montag“ im Oktober 1987 etwa fiel der Dow Jones um spektakuläre 23 Prozent. Im März 2000 platzte die sogenannte Dotcom-Blase, weil Internet- und Telekommunikationsunternehmen hoffnungslos überbewertet waren. Das reale Wachstum in den in der OECD zusammengeschlossenen Industriestaaten war aber in beiden Fällen kaum betroffen. Ganz anders verliefen die große Finanzkrise 2008 und der Anfang der Corona-Pandemie. 2009 schrumpften die OECD-Länder zusammen um 3,4, 2020 sogar um 3,9 Prozent. Während die große Finanzkrise durch überbewertete US-Immobilien und zweifelhafte Finanzierungsmodelle ausgelöst wurde, reagierten die Börsen im Jahr 2020 auf die kurzfristige Schließung ganzer Industriezweige und die Unterbrechung des Welthandels.
Crash-Folgen I: Trump postete gestern Durchhalte-Parolen. Die US-Amerikanerinnen und -Amerikaner sollten stark, mutig und geduldig sein, danach werde alles ganz wunderbar. Große Banken dagegen warnen vor einer Rezession: J.P. Morgan sieht für die USA nun eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 60 Prozent, Goldman Sachs erhöhte in seiner Einschätzung die Rezessionsaussicht von 20 auf 45 Prozent. Der Fondsmanager Bill Ackman, eigentlich ein Trump-Unterstützer, warnte bei einer Fortsetzung der radikalen Zollpolitik vor einem „wirtschaftlichen atomaren Winter“. Die USA trieben sich selbst in Richtung Rezession, sagte Kanadas Regierungschef Mark Carney.
Crash-Folgen II: Der Preis für die meistgehandelten Ölsorten liegt nur noch bei etwas über 60 Dollar pro Barrel und damit über 25 Prozent niedriger als vor einem Jahr, Russland kann sein Öl nur noch für gut 50 Dollar pro Barrel verkaufen. Auch Erdgas und Kupfer wurden billiger, weil mit geringerer Nachfrage gerechnet wird. Der Vix-Index, der die Unsicherheit an den Finanzmärkten abbildet, steht so hoch wie zuletzt in den ersten Zeiten der Pandemie.
Ehrenamtliche Kommunalpolitiker sehen eher in knappen Kassen als im Thema Migration das dringlichste Problem der nächsten Zeit. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung unter ehrenamtlichen Stadt- und Gemeinderäten. Tim Frehler berichtet. Demnach sagen 90 Prozent der Befragten, fehlende Finanzmittel seien die drängendste Herausforderung der kommenden Jahre. In der Aufnahme von Geflüchteten sehen hingegen 57 Prozent das drängendste Problem, im Osten liegt dieser Wert bei 44 Prozent.
Wenig Spielraum, viel Unzufriedenheit: 86 Prozent der Befragten beklagen die wachsende Bürokratie, 61 Prozent schrumpfende Gestaltungsspielräume. Mehr als jeder vierte Befragte beobachtet demokratiefeindliche Tendenzen in der eigenen Kommune, 25 Prozent berichten, sie selbst oder eine Person aus ihrem Umfeld seien aufgrund ihrer politischen Arbeit bereits beleidigt oder bedroht worden.
Mehr Geld fürs Personal: Die Befragung fand zwischen dem 31. Januar und dem 25. Februar statt. Nicht abgebildet ist daher der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst vom vergangenen Sonntag. Der gilt in den Kommunen als „harter Brocken“ (Deutscher Städtetag) oder als „schmerzhafter Tarifkompromiss“ (Deutscher Landkreistag). Ab dem 1. April erhalten die Beschäftigten drei Prozent mehr Geld, mindestens aber 110 Euro mehr im Monat. Ab dem 1. Mai 2026 kommen noch einmal 2,8 Prozent dazu. Für ihre Stadt bedeute jeder Prozentpunkt der Erhöhung Kosten in Höhe von gut 4,2 Millionen Euro jährlich, sagte Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner SZ Dossier. Bonn habe aber im Haushalt mit drei Prozent geplant und sei daher gut aufgestellt.
Mehr Flexibilität? Grundsätzlich vorteilhaft für ihre Stadt seien hingegen die Vereinbarungen zur Arbeitszeit: Beschäftigte erhalten ab dem Jahr 2027 einen weiteren Urlaubstag, ab 2026 gibt es die Möglichkeit, die wöchentliche Arbeitszeit freiwillig und befristet auf bis zu 42 Stunden zu erhöhen. Außerdem erhalten viele Beschäftigte ab dem kommenden Jahr die Möglichkeit, Teile der Jahressonderzahlung gegen bis zu drei freie Tage zu tauschen. Mehr Zeitsouveränität mache den öffentlichen Dienst attraktiver, sagte Dörner. „Da wir sehr um Fachkräfte ringen, ist das für uns ein Wettbewerbsvorteil.“ Die Arbeitszeit freiwillig auf 42 Stunden heraufzusetzen sei für ihre Stadt dort eine Möglichkeit, wo Fachkräfte fehlten oder es Überlastungen gebe.
Mehr arbeiten? Auf Seiten der Gewerkschaften gab es Bedenken angesichts der 42-Stunden-Regelung. Sie befürchten Druck auf Arbeitnehmer, länger zu arbeiten, berichtete die dpa aus Verhandlungskreisen. Verdi-Chef Frank Werneke betonte allerdings, niemand könne gedrängt werden, mehr zu arbeiten.
Zwei Wochen nach der Entscheidung der Bundesnetzagentur (BNetzA), die Nutzung von Mobilfunkfrequenzen nicht wie üblich zu versteigern, sondern bis 2030 kostenfrei zu verlängern, bezieht nun erstmals Vizepräsidentin Daniela Brönstrup ausführlich Stellung. Die Maßnahme sei notwendig gewesen, um eine künstliche Verknappung auf dem Markt zu vermeiden, sagte sie im Interview mit Matthias Punz vom Dossier Digitalwende.
Beim nächsten Mal wieder auktionieren: Auf der einen Seite sei mit 1&1 ein vierter Netzbetreiber dazubekommen, der sein Netz gerade aufbaut. Das sei wettbewerbstechnisch positiv. Auf der anderen Seite seien die frei werdenden Flächenfrequenzen für vier Anbieter „im Grunde zu wenig“, sagte Brönstrup. Für einen begrenzten Zeitraum zu verlängern, sei deshalb die bessere Entscheidung gewesen. „Dann ist ein größeres Spektrum frei, das wir dann wieder wettbewerblich vergeben können.“
Empfang an jeder Milchkanne: Brönstrup betonte zudem die strengen Flächenauflagen, die mit der Entscheidung verbunden sind. „Allein, dass alle Netzanbieter an den Kreisstraßen ausbauen müssen, wird einen großen Schub nach vorne bringen.“ Es gehe um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland, die die Behörde fördern will. „Da, wo wir jetzt noch weiße oder graue Flecken haben, sollte das in Zukunft nicht mehr der Fall sein.“
Leer ausgegangen: Dem Staat entgingen durch die Entscheidung große Summen. Im Jahr 2019 generierte die vergangene Auktion noch rund 6,6 Milliarden Euro. Das Geld floss in ein Sondervermögen Digitale Infrastruktur, das für den Gigabit-Ausbau und den Digitalpakt Schule verwendet wurde. „Ziel und Auftrag der Bundesnetzagentur ist es nicht, viel Geld für den Staat zu generieren“, sagte Brönstrup dazu. „Sondern knappe Ressourcen, in dem Fall Frequenzen, in effizienten Verfahren zu vergeben.“
Tiefgang
Auf der Suche nach handelspolitischen Möglichkeiten für einen Gegenschlag gegen die 20-prozentigen US-Pauschalzölle ist die EU sehr schnell bei einer Digitalsteuer gelandet. Dieses Instrument würde vor allem US-Tech-Konzerne wie Apple, Amazon, Meta und Alphabet treffen – und damit auch einige der reichsten Trump-Unterstützer.
Eine EU-Digitalsteuer ist bereits seit 2018 im Gespräch und hat einige bestechende Vorteile. Denn bisher zahlen die Tech-Konzerne trotz ihrer Milliardengewinne in der EU kaum Abgaben. Leider verteuert sie als Nebenwirkung aber auch ausgerechnet die Digitalisierung. Trotzdem spricht einiges für die Digitalsteuer als Gegenmaßnahme zu Trumps Zollpolitik.
Möglich wären folgende Varianten:
Digitalzoll: Das wäre ein Aufschlag auf importierte Software oder deren Bereitstellung in Echtzeit in der Cloud. So würde man digitale Abhängigkeiten bepreisen und europäische Eigenentwicklungen fördern. Der Digitalzoll hätte am ehesten den Charakter eines Handelsinstruments, weil er ausländische Anbieter trifft und einheimische Firmen verschont. Es bleiben aber zahlreiche ungeklärte Fragen. Was ist zum Beispiel, wenn die Software von der europäischen Tochter eines US-Konzerns bereitgestellt wird?
Digitalmaut: Auch eine Gebühr für den Zugang zu digitalen Infrastrukturen, also dem Netz, wird diskutiert. Dieses Instrument trifft die ohnehin schwache europäische Digitalindustrie aber gleichermaßen und könnte sogar international zum Wettbewerbsnachteil werden.
Abschöpfung der digitalen Wertschöpfung: Dabei wird der Umsatz besteuert, der durch den Beitrag der Nutzer zur Wertschöpfung digitaler Dienste erzeugt wird. Schließlich sind es gerade auf den sozialen Medien die Videos, Posts, Memes und sonstigen Beiträge, mit denen die Konzerne Kasse machen. Dieser Beitrag lässt sich allerdings kaum beziffern. Es handelt sich dabei auch um eine Abweichung der üblichen Steuerlogik, derzufolge Erträge da besteuert werden, wo das Unternehmen seinen Sitz hat – und nicht dort, wo die Wertschöpfung stattfindet.
Die Europäische Union hat eine Reihe guter Argumente für die Digitalsteuer. Die Tech-Konzerne gehören zu den profitabelsten Unternehmen der Welt, zahlen aber gerade in Europa kaum Steuern auf ihre gewaltigen Gewinne. So hat Apple am Standort Irland lange Zeit von einer Million Euro Gewinn nur 50 Euro an den Staat abgeführt. Da keine physischen Güter und keine Fabriken im Spiel sind, können Digitalkonzerne ihre Gewinne besonders geschickt dorthin verschieben, wo Ihnen die niedrigsten Unternehmenssteuern winken.
Schon seit 2018 liegen daher Vorschläge für eine europäische Richtlinie in Brüssel vor. Beispielsweise soll eine Digitalsteuer von drei Prozent dort ansetzen, wo digitale Geschäftsmodelle besonders profitieren: beim Handel mit Nutzerdaten, bei Online-Werbung und auf digitalen Marktplätzen. Blechen sollen nur die Großen.
Eine Digitalsteuer hat aber auch eine Reihe von Nachteilen:
Bremse für die Digitalisierung: Der Digitalverband Bitkom warnt, dass Europa bei der Modernisierung ohnehin hinterherhinke und sich eine Verteuerung digitaler Dienste daher nicht leisten könne. Die stärksten Anbieter kommen nun einmal derzeit aus Amerika, so die Logik: „Kosten würden erhöht, wo sie gegenwärtig eigentlich gesenkt werden müssten. Die Digitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung würde gebremst, wo sie doch dringend beschleunigt werden müsste“, sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.
Europäische Digitalanbieter wären ebenfalls betroffen. Zwar würde die Digitalsteuer nach den vorliegenden Richtlinienvorschlägen etwa zur Hälfte die US-Anbieter treffen, aber immerhin 40 Prozent der digitalsteuerpflichtigen Umsätze betreffen EU-Unternehmen.
Die Zeche zahlen EU-Bürger. Digitalfirmen könnten die höheren Kosten an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben, etwa durch eine Erhöhung der Netflix-Tarife. So wie vor allem die US-Konsumenten unter Trumps Zöllen leiden, könnte auch dieses Instrument die eigene Bevölkerung treffen.
Große mit Vorteilen: Die verschiedenen Varianten der Digitalsteuer setzen vor allem bei Transaktionen an, nicht bei den tatsächlichen Gewinnen. Die größten Konzerne mit den üppigsten Margen können sie am ehesten wegstecken. Das sind aber ausgerechnet Microsoft, Meta (Facebook), Alphabet (Google), Apple und Amazon.
Das Ifo-Institut hatte in einer Bewertung aus dem Jahr 2018 vor allem deshalb vor einer Digitalsteuer gewarnt, weil sie vor allem amerikanische Firmen trifft und somit den Handelskonflikt mit den USA anheizen könnte. Dieses Argument ist nun hinfällig, weil die USA den Konflikt bereits maximal eskaliert haben – und die EU nur noch nach Möglichkeiten sucht, Stärke zu demonstrieren.
Ohne den Handelskrieg, den Trump vom Zaun gebrochen hat, würden die Argumente gegen eine zusätzliche, komplizierte Steuer überwiegen. Die EU würde damit vor allem Steuervorteile ausgleichen, die den Digitalunternehmen an anderer Stelle eingeräumt wurden. Etwa durch das Niedrigsteuerland Irland oder durch Abschreibungen auf Sachinvestitionen. Das ließe sich an anderer Stelle eleganter korrigieren.
Als Handelsinstrument erhält die Digitalsteuer allerdings Rückenwind. Eine Amazon-Steuer ist ein Signal, das in Washington deutlich verstanden wird. In einem so heftigen Handelskonflikt, wie er aktuell tobt, steigt die Toleranz für Nebeneffekte. Finn Mayer-Kuckuk
Diesen Text haben Abonnentinnen und Abonnenten unseres Dossiers Geoökonomie bereits am Sonntagabend gelesen.
Fast übersehen
Deutschland soll mehr für den Katastrophenschutz tun. Das fordert das Innenministerium der SPD-Politikerin Nancy Faeser. „Angesichts der Entwicklung der sicherheitspolitischen Lage in jüngerer Zeit sollte ein stärkerer Fokus auf den Zivilschutz gesetzt werden, auch schon in der Schulbildung“, sagte ein Sprecher dem Handelsblatt. Es brauche ein „höheres gesellschaftliches Bewusstsein“. Schweden etwa setzt auf „strategische Kommunikation“ mit der Bevölkerung, wie der Minister für Zivilschutz Carl-Oskar Bohlin unlängst im Gespräch mit SZ Dossier sagte.
Neue EU-Strategie: Zurück nach Deutschland. Für die „Bestimmung von Lerninhalten“ an Schulen seien zwar die Länder zuständig, trotzdem stehe der Bund mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bereit, mit „Materialien für junge Menschen und für Lehrpersonen“ zu helfen. Auch „Erste-Hilfe-Kurse mit Selbstschutzinhalten“ würden vom BBK finanziert. Zuvor hatte die EU-Kommission die Mitgliedstaaten aufgefordert, im Rahmen einer neuen EU-Strategie Notfallvorbereitungen zu treffen: etwa Notvorräte für 72 Stunden.
Grüne fordern mehr Kompetenzen: Das Innenministerium begrüßte diese Initiative und nannte selbst Extremwetter, Hochwasser, Waldbrände oder Cyberangriffe als Gefahren, gegen die man sich „viel stärker als in der Vergangenheit wappnen“ müsse. Solche Ideen stießen zuletzt auf parteiübergreifende Zustimmung: Die Grünen forderten zuletzt in einem 10-Punkte-Plan gar, das BBK solle „vor allem in der länderübergreifenden Steuerung mehr Kompetenzen bekommen.“
Asylzahlen gesunken: Deutschland ist nicht mehr auf Platz eins bei den Asylanträgen in Europa. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) veröffentlichte eine Statistik, bei der Frankreich im Februar mit 13.080 und Spanien mit 12.975 Anträgen vor Deutschland mit 12.775 lagen. Internationale Zahlen für den März lagen noch nicht vor, die deutschen Zahlen gingen aber weiter auf 10.647 Anträge zurück – davon 8.983 Erstanträge. Insgesamt also 19,7 Prozent weniger als im Februar und 45,3 Prozent weniger als im März 2024.
Weniger Schutzsuchende aus Syrien und der Türkei: Im ersten Quartal 2025 sind laut des Berichts insgesamt 41.123 Asylanträge eingegangen, davon 36.136 Erstanträge. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es mit 71.061 Anträgen – davon 65.419 Erstanträge – deutlich mehr. Wie Innenministerin Nancy Faeser betonte, sei vor allem die Zahl der Schutzsuchenden aus Syrien und der Türkei zurückgegangen. „Wir haben durch ein starkes Bündel an Maßnahmen, durch eigenes deutsches Handeln und enge europäische Kooperation die irreguläre Migration nach Europa insgesamt und konkret nach Deutschland deutlich zurückgedrängt“, sagte Faeser.
Klimaneutrale Schifffahrt auf der Kippe: Der Schifffahrt werden beim CO₂-Ausstoß kaum Grenzen gesetzt – bislang. Dabei lag der Anteil der Branche laut der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) an den globalen Treibhausgasemissionen 2018 bei annähernd 2,9 Prozent. Das entspricht etwa dem CO₂-Ausstoß von Deutschland, berichtet Fabian Löhe in unserem Dossier Nachhaltigkeit. Die IMO, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, verhandelt von Montag bis Freitag in London über neue Vorgaben.
In dieser Woche könnte sich das ändern. Der zuständige Umweltausschuss erwartet laut Ankündigung, dass es unter den mehr als 170 Mitgliedsstaaten – darunter die USA, China und Deutschland – zu einer Einigung auf sogenannte mittelfristige Klimaschutzregeln kommt. Zur Abstimmung stehen sowohl ein Treibstoffstandard als auch ein CO₂-Preis-System. Ohne weltweiten Standard, so die Befürchtung, droht die Umstellung auf grüne Kraftstoffe wie Ammoniak, Methanol oder Biokraftstoffe internationales Stückwerk zu bleiben. Staaten wie beispielsweise China, Brasilien, Saudi-Arabien und etwa eines Dutzend anderer Länder stemmen sich dagegen.
Weltweite Standards notwendig: „Eine weltweite CO₂-Bepreisung ist unerlässlich, um fossile Brennstoffe zu verteuern, Investitionen in emissionsarme Technologien zu fördern und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen“, sagte Carsten Duif, Sprecher beim Verband Deutscher Reeder (VDR), SZ Dossier. „Gleichzeitig braucht es einen einheitlichen Treibstoffstandard, der endlich klare internationale Grenzen für die Kohlenstoffintensität von Schiffskraftstoffen setzt.“ Die Bundesregierung will sich in London gemeinsam mit den anderen EU-Staaten für ein „ambitioniertes Ergebnis“ einsetzen.
Unter eins
Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann will die EU-Abgeordnete Svenja Hahn als stellvertretende Parteivorsitzende vorschlagen, wie sie in der FAZ ankündigte
Zu guter Letzt
Heute erscheint der neue Begegnungsradar von More in Common. In dem „Werkstatt-Magazin“, das SZ Dossier vorab vorliegt, fasst der deutsche Ableger der internationalen Organisation zusammen, wie Begegnung und Zusammenhalt gestärkt werden sollen. „Im Alltag bewegen sich die meisten Menschen vor allem unter Gleichgesinnten. Der Austausch über gesellschaftliche Trennlinien hinweg findet häufig nicht statt“, heißt es im Vorwort.
Die Forschung des Projekts zeige aber gleichzeitig, dass sich „eigentlich alle Menschen einen besseren gesellschaftlichen Austausch und ein respektvolles und verbindendes Miteinander“ wünschen. In fünf Jahren hat das Projekt laut des Magazins fünf „Gestaltungsfelder“ gefunden, die Begegnungen fördern: öffentlicher Raum und Stadtplanung, Nahversorgung und Infrastruktur, Menschen und Ehrenamt, Nachbarschaft und Gemeinschaft sowie Freizeit und Kultur.
Belebte Plätze, barrierefreie Parks sowie gut gestaltete Innenstädte schaffen demnach natürliche Treffpunkte. Begegnung gelinge dort besonders gut, wo Menschen sich auf natürliche Weise begegnen. Auch die Nachbarschaft wird genannt, etwa mit Mehrgenerationenhäusern und Begegnungscafés. Und dann sind da noch die Sportvereine, die Menschen zusammenbringen – und oft knapp bei Kasse sind. Jenseits neuer Initiativen sei deshalb die „gezielte Förderung, Anerkennung und Unterstützung bestehender Begegnungsarbeit“ besonders wichtig.