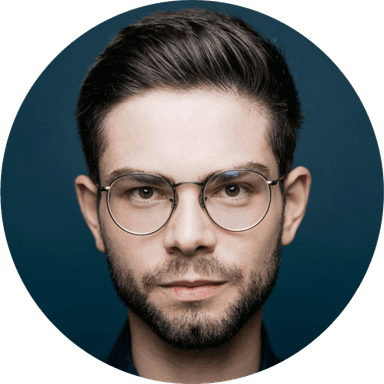Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerbenSchnelldurchlauf:
Ressorts und Personal: Wer führt welches Haus? +++ Finanzen: Die Entlastung kommt nur schrittweise +++ Migration: Wie der Kurswechsel gelingen soll +++ Wirtschaft und Industrie: Den Standort Deutschland stärken +++ Arbeit und Soziales: Länger, mehr und härter +++ Infrastruktur und Digitales: Endlich ein schlanker Staat? +++ Verteidigung und Außenpolitik: Sicherheit durch Abschreckung +++ Opposition wittert ihre Chance +++ Wie die neue Koalition gelingen soll
Guten Morgen. Friedrich Merz wusste es ja selbst. Und er gab es auch gleich zu. Das Ganze sei natürlich sehr technisch. Da hatte er in seiner Präsentation des Koalitionsvertrages gerade über die Körperschaftssteuer und das „Optionsmodell für Personengesellschaften“ gesprochen, das die künftige Regierung verbessern wolle.
Diejenigen unter seinen Zuhörerinnen und Zuhörern, die ihm da noch folgen konnten, wussten spätestens jetzt: Hier ist von nun an eine Koalition am Werk, deren Personal tief in der Materie steckt, die aber zumindest im Moment noch nicht die große Erzählung gefunden hat.
Die hatte die Ampel immerhin. Die selbst ernannte Fortschrittskoalition scheiterte am politischen Handwerk. Jetzt bekommt Deutschland eine Verantwortungskoalition. Das mag bieder klingen, aber vielleicht ist solides Handwerk ja das, was die Menschen vermissen. Ein Problem: Weite Teile dessen, worauf sich CDU, CSU und SPD geeinigt haben, stehen unter Finanzierungsvorbehalt.
Apropos Handwerk: US-Präsident Donald Trump pflegt eine ganz besondere Art des selbigen. Gestern kündigte er an, bestimmte Zölle für 90 Tage auszusetzen, wobei ein Sockelsatz von zehn Prozent bestehen bleibt. Auf China trifft das jedoch nicht zu: Für die Volksrepublik hat er sie noch einmal erhöht.
Herzlich willkommen am Platz der Republik.
Was wichtig wird
Eine der spannendsten Fragen ist wie immer: Welche Partei führt welches Haus? Obwohl die Koalition angekündigt hat, in den kommenden vier Jahren acht Prozent des Personals in den Bundesbehörden abbauen zu wollen, gründet sie noch schnell ein neues Ministerium, nämlich das für Digitales.
Die Häuser und ihre Parteien: Die CDU stellt den Bundeskanzler und den Chef des Bundeskanzleramtes (im Range eines Bundesministers) und wird die Ministerien für Wirtschaft und Energie; Bildung; Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Gesundheit; Verkehr; Digitalisierung und Staatsmodernisierung sowie das Auswärtige Amt verantwortlich sein. Die CSU führt drei Ministerien: Innen; Forschung, Technologie und Raumfahrt und Ernährung, Landwirtschaft und Heimat.
Die SPD hat anscheinend gut verhandelt. Sie hat sieben Ressorts für sich rausgeholt (und stellt naturgemäß den Vizekanzler). Die Sozialdemokraten stehen künftig den Ressorts Finanzen; Justiz und Verbraucherschutz; Arbeit und Soziales; Verteidigung; Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit; Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vor.
Es wird acht Staatsministerinnen und -minister geben: Bund-Länder-Zusammenarbeit (CDU), Kultur und Medien sowie Sport und Ehrenamt (alle CDU), drei im Auswärtigen Amt (zwei von der CDU, eine/r von der CSU). Der oder die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie der oder die Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland sollen von der SPD vorgeschlagen werden.
Und wer macht’s? Dazu ist noch nichts Stichfestes bekannt. Auch auf mehrere Nachfragen zum Personaltableau der kommenden Regierung ließen sich Merz, Söder, Klingbeil und Esken zu keiner Aussage hinreißen. Erst soll alles stehen, durch die Parteigremien und Mitgliederentscheide, dann werden die Posten verteilt – beziehungsweise bekanntgeben – hieß es gestern.
In der Finanzpolitik hat für die neue Koalition die Entlastung der Unternehmen Vorrang vor der Entlastung aller Steuerzahler. Kurzfristig soll eine auf 30 Prozent erhöhte degressive Abschreibung auf Ausrüstungsinvestitionen einen „Investitions-Booster“ auslösen. Sie gilt rückwirkend ab 1. Januar 2025 und für drei Jahre. Danach wird die Körperschaftsteuer schrittweise gesenkt, um jeweils einen Prozentpunkt. Ein Punkt bedeutet laut Stefan Bach vom DIW Einnahmeausfälle von etwa vier Milliarden Euro. Für Personenunternehmen soll es leichter werden, den günstigeren Steuersatz bei der Körperschaftsteuer im Gegensatz zur Einkommensteuer anzuwenden.
Es gibt kein Klimageld: Dazu kommen für die Wirtschaft noch Entlastungen bei der Stromsteuer und der versprochene Bürokratieabbau. Da der auch von Firmen zu zahlende Solidaritätszuschlag bleibt, sind die Entlastungen deutlich geringer als noch vergangene Woche von den großen Verbänden gefordert. Die Entlastung der Unternehmen komme deutlich später als notwendig, kritisierte der Bundesverband der Deutschen Industrie. Den normalen Lohn- und Einkommensteuerzahlern verspricht die Koalition eine Reform zur Mitte der Wahlperiode, legt sich aber auf keine Größenordnung fest. Ein Klimageld für alle Bürger, mit dem die steigenden CO₂-Abgaben zurückgegeben werden, wird es nicht geben. Die Einnahmen würden durch die niedrigere Stromsteuer und Klimainvestitionen den Bürgern zugutekommen.
Ein Haufen roter Linien: Einen größeren Wurf erschwert hat nicht nur die angespannte Haushaltslage. Vor allem die verschiedenen roten Linien der Verhandlerinnen und Verhandler haben ein größeres Paket verhindert. Die Union wollte um keinen Preis Steuererhöhungen, die stärkere Senkungen an anderer Stelle hätten finanzieren können, auch der Abbau von Subventionen etwa für Dienstwagen oder Diesel fällt offenbar in diese Kategorie. Die SPD stemmte sich gegen Einsparungen bei der Rente, die den Anstieg der Lohnnebenkosten hätte stoppen können. Und die CSU verringerte mit ihren schon im Sondierungspapier durchgesetzten Forderungen nach Ausweitung der Mütterrente, Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie, steuerfreiem Agrardiesel und höherer Pendlerpauschale den Spielraum weiter.
Das liebe Sondervermögen: Die ständige Rücksprache der Koalitionäre mit dem amtierenden Finanzminister Jörg Kukies hat dazu geführt, dass die Aufstellung des Haushalts 2025 und die Finanzplanung ohne allzu große Schwierigkeiten möglich sein dürfte. Wo möglich, soll gespart werden, beim Bürgergeld, aber auch etwa bei der Entwicklungszusammenarbeit. Die Kunst wird darin bestehen, das neue Sondervermögen effektiv auszugeben, damit die optimistische Annahme, dass jeder aus den neuen Schulden finanzierte Euro drei Euro zusätzliche Wirtschaftsleistung schafft, auch aufgeht. Aber die Gefahr besteht, dass ohnehin fällige Ausgaben aus den 500 Milliarden bezahlt werden. So ist etwa jetzt schon geplant, wegen der Krankenhausreform nötige Investitionen in die Krankenhäuser aus dem Infrastruktur-Topf zu bezahlen, einschließlich einer Finanzierungslücke, die sich seit 2023 aufgetan hat.
Einen „neuen Kurs in der Migrationspolitik“ kündigte Friedrich Merz gestern erneut an. Das Thema war eines der umstrittensten zwischen Union und SPD. In der Arbeitsgruppe waren zahlreiche Punkte strittig geblieben. Der Koalitionsvertrag zeigt nun: Es regiert der Kompromiss.
Zurückweisen, aber wie? Schon im Wahlkampf war der Union der Punkt der Zurückweisungen an der Grenze wichtig. Im Koalitionsvertrag steht wie im Sondierungspapier, dass „in Abstimmung“ mit den europäischen Nachbarn zurückgewiesen werden soll, auch wenn Asylanträge gestellt werden. Auf die Frage, was das bedeute, sagte Merz: „Abstimmung bedeutet Abstimmung.“ Hier wird es also auf das Innenministerium ankommen.
Punkt für die SPD: Die Union drängte laut AG-Papier darauf, Asylverfahren in sicheren Drittstaaten zu ermöglichen. Darauf konnten sich die Parteien nicht einigen. Die neue Bundesregierung will aber auf europäischer Ebene die Initiative ergreifen, um das sogenannte Verbindungselement im EU-Recht zu streichen, wonach Flüchtlinge nur in einen Drittstaat gebracht werden dürfen, zu dem sie eine Verbindung haben. Ideen wie dem Ruanda-Modell steht es damit im Weg.
Durchgesetzt hat sich die Union hingegen in einem anderen Punkt. Im Asylrecht soll zukünftig nicht mehr der „Amtsermittlungsgrundsatz“ gelten, sondern der „Beibringungsgrundsatz“ – für Asylbewerber hätte das weitreichende Konsequenzen. Behörden und Gerichte müssten einen Sachverhalt dann nicht mehr von Amts wegen erforschen, sondern würden nur prüfen, „was die Asylbewerber vortragen oder anderweitig evident ist“, sagte der Migrationsexperte Daniel Thym der SZ. Asylsuchende müssten also die „politischen, sozialen und technischen Zusammenhänge im Herkunftsland eigenständig darlegen“, heißt es etwa bei Pro Asyl. Vereinfacht gesagt, würde die Beweislast verschoben.
Punkt für beide: In Sachen Staatsangehörigkeitsrecht verbucht die Union die Abschaffung sogenannter „Turboeinbürgerungen“ für sich als Erfolg. Die SPD kann sich auf die Fahnen schreiben, dass es erst einmal nicht zu weiteren Verschärfungen gekommen ist.
Erstmal prüfen: In anderen Punkten verlegten sich die Verhandler darauf, den Konflikt nicht aufzulösen, sondern erst einmal zu prüfen. Die Union wollte zum Beispiel Ausreisezentren in der Nähe von Flughäfen einrichten, um Abschiebungen zu erleichtern. Die SPD wollte das nicht. Nun soll die Sache geprüft werden.
Änderung für Ukrainer: Einig waren sich die Verhandler bereits in der Arbeitsgruppe dabei, die Liste sicherer Herkunftsländer auszuweiten oder den Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter für zwei Jahre auszusetzen. Neu im Vergleich zum Ergebnis der Arbeitsgruppe sind Änderungen für Geflüchtete aus der Ukraine. Diejenigen von ihnen, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommen sind, sollen kein Bürgergeld mehr, sondern Leistungen für Asylbewerber erhalten.
Der Standort Deutschland soll nach wieder „nach vorne“ gebracht werden. Die Koalition sieht dafür eine Wirtschaftspolitik vor, „die Investitionen, Innovationen und Wettbewerb fördert, Steuern, Abgaben und Energiepreise senkt, Arbeitsanreize verbessert, die Dekarbonisierung unterstützt, Bürokratie zurückbaut und eine aktive Handelspolitik betreibt“. Über den „Deutschlandfonds“ soll Investitionen angeschoben werden. Dafür sollen mindestens zehn Milliarden Euro Eigenmittel des Bundes bereitgestellt und durch privates Kapital und Garantien auf mindestens 100 Milliarden Euro gehebelt werden.
Strom wird billiger: Zur Mitte der Legislatur wird, wie von der Union gewünscht, die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen gesenkt. Außerdem sollen Unternehmen, aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher, um mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde entlastet werden, und zwar durch Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß; die Netzentgelte sollen reduziert werden.
Medizin für den Standort: Die Chemie-, Pharma- und Biotechnologiebranche wird zu einer der „innovativsten weltweit“, hat Schwarz-Rot beschlossen, dafür soll es unter anderem eine Nationale Pharmastrategie geben. „Ein Totalverbot von Stoffgruppen lehnen wir ab“, steht im Vertrag. In diesem Zusammenhang heißt das wohl das deutsche Nein zum auf EU-Ebene verhandelten Verbot von PFAS, den sogenannten Ewigkeitschemikalien.
Und er läuft und läuft und läuft. Die Automobilindustrie wird sich freuen, weil Markus Söder versprach: „Wir setzen uns bewusst für das Auto ein.“ Es werde keine „Technikattacke“ geben, im Koalitionsvertrag heißt es ein wenig diplomatischer „Technologieoffenheit“. Soll heißen: Ja zur E-Mobilität, aber nicht um jeden Preis. Man wolle sich „aktiv dafür einsetzen, Strafzahlungen aufgrund der Flottengrenzwerte abzuwehren“. Um die Aufrüstung Deutschlands zu beschleunigen, soll geprüft werden, wie die Umrüstung und Ertüchtigung von Stahl- und Automobilwerken für die Bedarfe der Verteidigungsindustrie genutzt werden können.
Zu den Sternen: Weil‘s so schön ist, zwischen all den harten Fakten – in Sachen Raumfahrt hat sich Schwarz-Rot auch was überlegt. Sinnvolles, wie die Beteiligung am europäischen Ausbau von Satellitensystemen zur militärischen Überwachung oder zur Vorhersage von Unwettern. Und: „Wir streben an, dass eine deutsche Astronautin oder ein deutscher Astronaut im Rahmen einer internationalen Mission zum Mond fliegt.“ Na dann.
Das Bürgergeld ist passé, wie zu erwarten war. Ab jetzt heißt es „neue Grundsicherung“ und für Arbeitssuchende gilt künftig das Prinzip „Fördern und Fordern“: Es soll effizienter vermittelt werden; wer sich den Vermittlungsversuchen nicht nachgeht, soll schneller sanktioniert werden: „Sanktionen müssen schneller, einfacher und unbürokratischer durchgesetzt werden können.“ Menschen, die arbeiten können und wiederholt zumutbare Arbeit verweigern, droht ein vollständiger Entzug der Sozialleistungen.
15 Euro als Orientierung: Eine Kernforderung der SPD, die Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro, hat es nicht fest in den Vertrag geschafft. Es soll lediglich an einer „starken und unabhängigen Mindestlohnkommission“ festgehalten werden, die sich in ihrer Abwägung an Tarifentwicklung und Bruttomedianlohn „orientiert“: „Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar.“ Ob er denn aber auch erreicht werden soll, darauf bleibt Schwarz-Rot eine Festlegung schuldig. Weiter hat sich die Union auch bei der Arbeitszeit durchgesetzt: Es soll künftig eine wöchentliche anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit gelten, aber: „Kein Beschäftigter darf gegen seinen Willen zu höherer Arbeitszeit gezwungen werden.“
Die Rente ist sicher – zumindest bis 2031. Bis dahin garantiert Schwarz-Rot ein Rentenniveau von 48 Prozent. Ab 2026 wird die „Frühstart-Rente“ eingeführt: Dafür will die Koalition für jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr, das eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, pro Monat zehn Euro in ein kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot einzahlen. Wer nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente gehen will, kann das auch künftig tun, gleichzeitig soll freiwilliges längeres Arbeiten belohnt werden. Bei der Aktivrente bekommt, wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und weiterarbeitet, sein Gehalt bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei.
Wer arbeitet, darf kommen – sogar aus dem Ausland: Fachkräftezuwanderung ist gewünscht und soll gefördert werden, dafür wird eine digitale Agentur unter dem schmissigen Titel „Work-and-stay-Agentur“ gegründet. Es sollen „alle Register“ gezogen werden, damit die Fachkräftesicherung in den nächsten Jahren gelingt. Damit Frauen, äh Familien, den Spagat zwischen Arbeit und Care-Arbeit bessern meistern können, soll es ein jährliches „Familienbudget für Alltagshelfer für Familien mit kleinen Kindern und/oder pflegebedürftigen Angehörigen mit kleinen und mittleren Einkommen“ geben.
Schwarz und Rot wollen noch in diesem Jahr eine „ambitionierte Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung“ erarbeiten. Dabei sollen vor allem die Vorschläge der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ aufgegriffen werden. Und auch sonst haben die Koalitionäre in den Bereichen Digitales, Staatsreform, Bürokratieabbau und Infrastruktur zahlreiche Vorhaben aufgelistet.
Digitale Verwaltung: Das Digital-Only-Prinzip soll für die Verwaltung eingeführt werden. Verwaltungsleistungen sollen darüber hinaus über eine zentrale Plattform, einen One-Stop-Shop, ermöglicht werden. Dafür erhält jeder Bürger verpflichtend ein Bürgerkonto und eine digitale Identität. Wer den digitalen Weg nicht gehen will oder kann, soll Hilfe vor Ort erhalten. Ebenfalls kommen soll der Once-Only-Grundsatz. Heißt: Bürger und Unternehmen sollen ihre Daten gegenüber dem Staat nur einmal angeben müssen. Mehr zur digitalen Verwaltung und zum neuen Digitalministerium hat heute unser Dossier Digitalwende.
Moderner Staat: Das Personal in der Ministerial- und Bundestagsverwaltung sowie in „bestimmten nachgeordneten Behörden“ soll bis 2029 um mindestens acht Prozent reduziert werden. Die Union hatte zuvor 15 Prozent als Zielmarke definiert. Die Beauftragten beim Bund sollen um rund 50 Prozent reduziert werden. Wie bereits im Sondierungspapier beschrieben, soll das Ressortprinzip unter anderem durch interministerielle Projektteams neu interpretiert werden.
Bürokratieabbau und Recht: Im Laufe des Jahres soll ein „Sofortprogramm für den Bürokratierückbau“ kommen. Einige Pläne gibt es schon: Schwarz-Rot will unter anderem die Bonpflicht abschaffen. Auch das nationale Lieferkettengesetz und seine Berichtspflichten sollen weg. Stattdessen soll die europäische Regelung „bürokratiearm“ umgesetzt werden. Die Bürokratiekosten für die Wirtschaft sollen um 25 Prozent reduziert werden. Das Informationsfreiheitsgesetz „in der bisherigen Form“ soll „mit einem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung“ reformiert werden. Schriftformerfordernisse sollen „wo immer möglich“ abgeschafft werden.
Wohnen, Bauen, Verkehr: Das Planungsverfahrensrecht soll grundsätzlich überarbeitet werden. Ziel ist hier ein einheitliches Verfahrensrecht für Infrastrukturvorhaben. Wohnungsbau und Eigentumsbildung sollen angekurbelt werden, Zahlen nennt Schwarz-Rot aber nicht. Dafür planen die Koalitionäre einen „Wohnungsbau-Turbo“ in den ersten 100 Tagen. Das Heizungsgesetz soll abgeschafft, das neue Gebäudeenergiegesetz „technologieoffener, flexibler und einfacher“ werden. „Die erreichbare CO₂-Vermeidung soll zur zentralen Steuerungsgröße werden“, heißt es dazu im Vertrag. Die Mietpreisbremse wird für vier Jahre verlängert. Das Deutschlandticket bleibt über 2025 hinaus, ab 2029 gibt es „sozialverträgliche“ Preiserhöhungen.
In der Außen- und Sicherheitspolitik setzt Schwarz-Rot auf den bewährten Grundsatz: „Wir wollen uns verteidigen können, um uns nicht verteidigen zu müssen.“ Die größte Bedrohung geht von Russland aus – die Bundeswehr soll einen „zentralen Beitrag“ zur Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der Nato leisten und die Landes- und Bündnisverteidigung „uneingeschränkt“ erfüllen. Schwarz-Rot will Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik gemeinsam denken. Das Entwicklungsministerium bleibt als eigenständiges Ressort bestehen.
Was den Bundessicherheitsrat angeht, setzt sich die Union durch. Er soll sich zu einem Nationalen Sicherheitsrat im Bundeskanzleramt weiterentwickeln. Dazu passt, dass die CDU das Außenamt bekommt. Der Sicherheitsrat soll die „wesentlichen Fragen einer integrierten Sicherheitspolitik koordinieren, Strategieentwicklung und strategische Vorausschau leisten“ sowie eine „gemeinsame Lagebewertung“ vornehmen. Zudem kommt, wie von der SPD gefordert, ein Bund-Länder- und ressortübergreifender Nationalen Krisenstab der Bundesregierung und ein Nationales Lagezentrum, beides im Bundeskanzleramt.
Zur Außenpolitik: Genannt werden „materielle und politische Sicherheitsgarantien für eine souveräne Ukraine“, auf die nicht näher eingegangen wird. Zudem werde sich Deutschland am Wiederaufbau der Ukraine beteiligen. Die Beziehungen zu den USA bleiben laut des Papiers „von überragender Bedeutung“, die transatlantische Partnerschaft gelte es auch „unter den neuen Bedingungen“ fortzusetzen. Einen Kompromiss gab es in der Passage zu Israel: Rüstungsexporte werden nicht konkret erwähnt, stattdessen heißt es nur noch, Deutschland unterstütze Israel bei der „Gewährleistung der eigenen Sicherheit“. Die humanitäre Lage im Gazastreifen müsse „grundlegend verbessert“ werden.
Zur Verteidigung: Die Höhe der Verteidigungsausgaben wird nicht – wie von der Union gewünscht – beziffert. Stattdessen richte sie sich nach den in der Nato gemeinsam vereinbarten Fähigkeitszielen. In den Koalitionsvertrag geschafft hat es das Vorhaben, einen mehrjährigen Investitionsplan für die Verteidigungsfähigkeit über die Legislaturperiode hinaus einzuführen, der langfristige finanzielle Planbarkeit gewährleistet. Eine Wehrpflicht kommt nicht, stattdessen das schwedische Modell eines „zunächst“ freiwilligen Wehrdienstes. Hier hat sich also die SPD durchgesetzt. Zudem soll das Planungs- und Beschaffungswesen reformiert werden.
Lob aus der Opposition hatten Union und SPD sicherlich ohnehin nicht erwartet. Die Wortmeldungen von AfD, Grünen und Linken fielen aber in ihrem Ton deutlich aus. AfD-Chefin Alice Weidel nutzte ihren Auftritt auf der Fraktionsebene gestern, um ihren Hauptgegner anzugreifen: Der Koalitionsvertrag sei eine „Kapitulationsurkunde“ von Friedrich Merz und von CDU/CSU. Das Papier trage durchgehend die Handschrift „des Wahlverlierers SPD“.
Grüne in Sorge vor Rechtsruck: Karoline Otte, Bundestagsabgeordnete der Grünen, sagte angesichts einer neuen Ipsos-Umfrage, die die AfD vor der Union sieht, die Lage sei zu ernst für ein „Groko-Weiter-so“. Die neue Regierung beweise auf 144 Seiten, dass ihr dazu nichts anderes einfalle, „als den Rechtsruck weiter mitzugehen“. Dauerhafte Grenzkontrollen, Abwicklung des Bürgergeldes und der Rückbau von Klimapolitik seien „abgeschriebene AfD-Programmatik“, sagte Otte SZ Dossier.
Linke mit dem Filzstift: Aus den Reihen der Linken präsentierten Parteichefin Ines Schwerdtner und Fraktionschefin Heidi Reichinnek gestern ein leicht angepasstes Deckblatt des Koalitionsvertrages. Der trägt eigentlich die Überschrift „Verantwortung für Deutschland“, die beiden Politikerinnen ergänzten in roter Farbe vier Buchstaben, sodass daraus „Verantwortungslos für Deutschland“ wurde. Die Pläne von Union und SPD nannte Schwerdtner „mutlos, fantasielos und ohne sozialen Kompass“.
Alles anders, alles neu – das war der Plan für die Zusammenarbeit in der neuen Regierung. Ein kürzerer Koalitionsvertrag sollte es werden, eine agilere Form des Regierens. Davon übrig geblieben ist vor allem das, was im letzten Kapitel des Koalitionsvertrags steht: ein Koalitionsausschuss, der monatlich tagt. Davon abgesehen liegt ein klassischer Koalitionsvertrag vor, auf 144 Seiten.
Monatliche Treffen: „Die Koalitionspartner treffen sich grundsätzlich monatlich zu Koalitionsgesprächen im Koalitionsausschuss. Darüber hinaus tritt der Koalitionsausschuss auf Wunsch eines Koalitionspartners zusammen“, heißt es im Papier. Er berät „Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, die zwischen den Koalitionspartnern abgestimmt werden müssen“ – und führt in Konfliktfällen Konsens herbei. In Streitfällen soll dieser, anders als bei der Ampel, hinter verschlossenen Türen beigelegt werden, betonte Merz gestern.
Vor allem einer dürfte profitieren: Markus Söder. Er wird als Parteichef der CSU am Tisch sitzen. Auf die Frage, ob es einen oder zwei Vizekanzler geben wird, sagte er gestern, die CSU stelle nicht den Vizekanzler. „Aber Sie werden von mir hören“, fügte er hinzu. Eine Anspielung auf seine neue Rolle im Koalitionsausschuss, eine auf wirklicher Augenhöhe mit den anderen Parteichefs, wie ein Mitglied der CSU-Führung sagte.
Der Rest liest sich wie immer. Es wird festgehalten, dass die Koalitionsfraktionen einheitlich abstimmen. „Wechselnde Mehrheiten sind ausgeschlossen“, heißt es. Anträge, Gesetzesinitiativen und Anfragen auf Fraktionsebene sollen gemeinsam oder „im Ausnahmefall“ im gegenseitigen Einvernehmen eingebracht werden. Im Kabinett soll bei Entscheidungen kein Koalitionspartner überstimmt werden.
Enthalten ist auch eine Anti-AfD-Klausel. Die demokratischen Parteien der politischen Mitte trügen demnach eine besondere Verantwortung für den Schutz und die Stärkung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dann heißt es: „Die Koalitionspartner schließen auf allen politischen Ebenen jede Zusammenarbeit mit verfassungsfeindlichen, demokratiefeindlichen und rechtsextremen Parteien aus.“ Das betreffe im Parlament gemeinsame Anträge, Wahlabsprachen und sonstige Formen der Zusammenarbeit.
Zum Wahlrecht: Eine Wahlrechtskommission soll die Wahlrechtsreform evaluieren und noch in diesem Jahr vorschlagen, wie jeder Bewerber mit Erststimmenmehrheit in den Bundestag einziehen und das Parlament trotzdem bei seiner aktuellen Größe verbleiben kann. Dabei soll auch geprüft werden, wie die gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen im Parlament gewährleistet werden kann – und ob Menschen ab 16 Jahren an der Wahl teilnehmen sollten.
Unter eins
Die Co-Chefin der Grünen, Franziska Brantner, ist vom Koalitionsvertrag nicht begeistert
Wie es jetzt weitergeht
Nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags haben Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Alexander Dobrindt die Verhandlungsergebnisse in ihren Fraktionen beziehungsweise der CSU-Landesgruppe präsentiert. Das Ziel steht fest: In der ersten Maiwoche soll Merz zum Bundeskanzler gewählt werden, als Termin wird noch immer der 7. Mai gehandelt.
Bis dahin stehen noch einige Termine an: Die CSU ist als erste Koalitionspartnerin dran, heute noch will ihr Vorstand über den Vertrag entscheiden. Die CDU plant dafür am 28. April einen „Kleinen Parteitag“ in Berlin. Etwas länger dauert der Entscheidungsprozess in der SPD. Zwischen dem 15. und 29. April können alle 358 322 Mitglieder online über den Koalitionsvertrag abstimmen, am 14. und 26. April finden dazu zwei große Dialogveranstaltungen in Hannover und Baunatal bei Kassel statt.
Am 30. April soll laut SPD das Ergebnis des Mitgliedervotums verkündet werden. Möglicherweise könnten die Koalitionäre noch am selben Tag den Vertrag unterzeichnen, auch das Personal sollte bis dahin stehen. Falls alles nach Plan verläuft, könnte Merz schon eine Woche nach der Vereidigung seine erste Regierungserklärung halten. Es wäre die nächste reguläre Sitzungswoche des Bundestags.