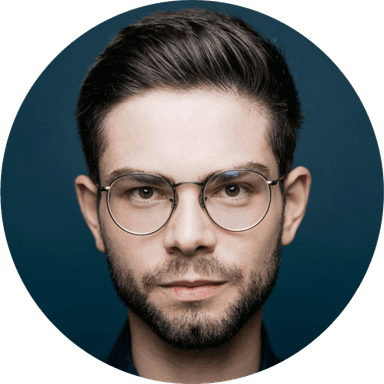Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerben
Der erste Streit von Schwarz und Rot
Montag, 14. April 2025Guten Morgen. In der ostukrainischen Stadt Sumy sind gestern bei einem schweren russischen Raketenschlag nach ukrainischen Angaben mindestens 31 Personen gestorben, darunter zwei Kinder. Während die Menschen am Palmsonntag in die Kirche gegangen seien, um an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem zu erinnern, hätten russische Raketen die Stadt getroffen, teilte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit.
Laut dem geschäftsführenden Bürgermeister Artem Kobsar schlugen zwei ballistische Raketen im Zentrum der Stadt ein. Es ist eine Mahnung: Der Krieg in der Ukraine, der russische Terror gegen ukrainische Zivilisten, ist noch lange nicht vorbei. Merz attestierte Russland gestern Abend bei Caren Miosga „schwerste Kriegsverbrechen“. „Das ist das, was Putin mit denen macht, die mit ihm über einen Waffenstillstand sprechen“, sagte er. Wir blicken heute darauf, was sich die schwarz-roten Koalitionäre in Sachen Ukraine vorgenommen haben.
Derweil beginnt morgen die Mitgliederbefragung in der SPD. Friedrich Merz hat das Wochenende davor noch genutzt, um zwei sozialdemokratische Kernthemen aus dem Koalitionsvertrag abzuräumen. Und sonst so? Die letzten Monate, sagte Merz, seien anstrengend gewesen. Es werde jetzt Zeit, dass er in ein paar Tagen, über Ostern, zur Ruhe komme. Das neue Zieldatum für seine Kanzlerwahl ist übrigens der 6. Mai.
Willkommen am Platz der Republik.
Was wichtig wird
Schwarz-Rot wollte weniger streiten als die Ampel. Und auch sonst sollte das Klima innerhalb der Koalition ein anderes sein. Die neue Regierung ist noch nicht mal im Amt, da hat sie schon ihre ersten Meinungsverschiedenheiten, die sie auf offener Bühne austrägt. Es geht vor allem ums Geld. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte erklärt, welche Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt stehen –und welche nicht. Die im Vertrag mit „wir werden“ eingeleiteten Vorhaben sollten kommen, für die mit „wir wollen“ eingeleiteten Vorhaben müsse noch eine Finanzierung gefunden werden. Dieser Darstellung hat nun Bundeskanzler in spe Friedrich Merz widersprochen.
Es geht um zwei Maßnahmen. Da ist zunächst die Einkommensteuerentlastung für Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen. „Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken“, heißt es dazu im Koalitionsvertrag. Merz sagte wiederum gestern der Bild am Sonntag, diese sei „nicht fix“. Er verwies darauf, dass die Union die Steuersenkung gerne mit den Sozialdemokraten „von Anfang an“ verabredet hätte, es darüber aber einen Dissens gegeben habe. „Deswegen haben wir es offengelassen“, sagte er. Man senke die Unternehmensbesteuerung – und die Einkommensteuer wolle man senken, wenn es der öffentliche Haushalt hergebe.
Werden oder sollen? Zwar steht im Koalitionsvertrag auch, dass alle Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt stünden. Aber Klingbeil und anschließend auch CDU-Mann Thorsten Frei hatten erläutert, wie die Formulierungen zu verstehen seien. Im Bericht aus Berlin betonte Klingbeil gestern, an den Entlastungen zur Mitte der Legislatur gebe es „kein Wackeln“. Merz präzisierte seine Aussage am Sonntagabend: „Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können“, sagte er bei Caren Miosga.
Einen weiteren Dissens gibt es beim Mindestlohn. „Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben“, sagte Merz der Bild am Sonntag. Der Mindestlohn könne Anfang 2026 bei den genannten 15 Euro liegen – oder auch später. „Das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.“
In der SPD sieht man das anders. In internen Papieren und auf offener Bühne verkaufen sie die Erhöhung als gesetzt. „Der Mindestlohn wird im Jahr 2026 auf die 15 Euro steigen, die wir haben wollen“, hatte Klingbeil am Donnerstag gesagt. „Wir haben im Koalitionsvertrag klar die Orientierung am europäischen Mindestlohnziel, also 60 Prozent des Medianlohns, verankert“, sagte SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt am Wochenende. Damit sei der Weg geebnet: „Der Mindestlohn wird sich dynamisch bis 2026 in Richtung 15 Euro entwickeln.“
Interpretationsspielraum: Schuld sind in beiden Fällen die vagen Formulierungen im Koalitionsvertrag. Ein Mindestlohn von 15 Euro sei bis 2026 „erreichbar“, heißt es darin. Was den Mindestlohn betrifft, könnten am Ende beide richtig liegen: Die Erhöhung liegt in den Händen der Mindestlohnkommission, dazu hat sich auch die SPD bekannt. „Es gilt das, was im Text steht: Wir halten die 15 Euro für erreichbar“, sagte Klingbeil im Bericht aus Berlin. Wenn sich die Mindestlohnkommission an all die Kriterien halte, die in ihrer Geschäftsordnung drin sind, dann erreiche man 2026 die 15 Euro.
Sieben Ministerien, darunter das mächtige Finanzressort und das Verteidigungsministerium, ebenso viele wie die CDU, das ist keine schlechte Verhandlungsbilanz für die SPD-Parteiführung. Ob es reicht, die Mitglieder davon zu überzeugen, dass die schwarz-rote Koalition tatsächlich auch die Handschrift der Sozialdemokratie trägt? Elena Müller berichtet.
Lars Klingbeil bemüht Lage und Verantwortung. Für diese Verantwortung haben die Sozialdemokraten auch einen gehörigen Teil früherer Anliegen auf dem Verhandlungstisch gelassen: In der Migrationspolitik etwa, in der sich die Union mit ihren Forderungen weitgehend durchgesetzt hat. In der Sozialpolitik sind es das Ende des Bürgergeldes und härtere Sanktionen für unkooperative Arbeitssuchende. „Wenn es gelingt, zwischen SPD und CDU/CSU Brücken zu bauen, kann das auch an anderen Stellen in der Gesellschaft gelingen“, heißt es in einem SPD-Papier.
Damit die Mitglieder am Ende zustimmen, bemüht sich die SPD vor dem Mitgliedervotum also um positive Kommunikation. Teile des Parteinachwuchses hat sie bereits verloren: Mehrere Juso-Verbände haben am Wochenende Widerstand angekündigt – die in Bayern und Schleswig-Holstein lehnen den Koalitionsvertrag ab. Morgen beginnt das Votum, heute hält die SPD in Hannover eine erste „Dialogkonferenz“, um Mitglieder vom Segen der Koalition zu überzeugen – mit hohem personellem Einsatz: Aus der Chefgruppe der Verhandlungen sind neben Klingbeil und Saskia Esken auch Matthias Miersch, Hubertus Heil, Boris Pistorius und Manuela Schwesig dabei.
In einem „Argu-Papier“ gibt es die Argumente dafür. Die SPD listet auf, was sie in den Verhandlungen erreicht hat: die Investitionen etwa, eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse, bessere Abschreibungsmöglichkeiten. Ein höherer Mindestlohn soll laut des Papiers bis 2026 kommen: die Stabilisierung des Rentenniveaus, sowie die Reform der Einkommensteuer. Einen Haken gibt es da nur: Der Mindestlohn liegt in der Hand der Mindestlohnkommission – und auch bei anderen Punkten herrscht wieder Unklarheit (siehe oben). Ob das mit den Brücken wirklich gelingt, wird erst der Regierungsalltag zeigen.
Wer den Koalitionsvertrag unter den Gesichtspunkten zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der hybriden Bedrohung aus Moskau durchliest, findet nicht viele konkrete Passagen. „Dass die CDU in ihrem Koalitionsvertrag kein Wort über den Taurus verliert als Beispiel für moderne Waffensysteme, die hoch wirkungsvoll sind, die Olaf Scholz bisher aber verhindert hat, zeigt, dass die CDU-Anträge diesbezüglich im Bundestag nur Show waren“, sagte FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann SZ Dossier.
Bei Miosga klang Merz anders. „Ich bin nicht davon überzeugt, dass Putin auf Schwäche und Friedensangebote positiv reagiert“, sagte er auf die Frage nach einer Taurus-Lieferung. Nachdem er die europäischen Partner aufgeführt hatte, die bereits Marschflugkörper liefern, fügte er hinzu: „Wenn es abgestimmt wird, dann sollte Deutschland sich daran beteiligen.“ Möglicherweise könnte Merz eine solche Entscheidung als Bundeskanzler im Nationalen Sicherheitsrat – der laut Koalitionsvertrag geplanten Weiterentwicklung des Bundessicherheitsrats – per Richtlinienkompetenz herbeiführen.
Ein Blick in den Koalitionsvertrag: Man wolle die Ukraine „umfassend unterstützen“, damit sie sich gegen den russischen Aggressor „effektiv verteidigen und sich in Verhandlungen behaupten“ könne. Und: Man werde Deutschlands „militärische, zivile und politische Unterstützung der Ukraine gemeinsam mit Partnern substanziell stärken und zuverlässig fortsetzen“. Gemeinsam mit diesen will Deutschland sich auch für einen „echten und nachhaltigen Frieden“ einsetzen. Wenn es um ein Szenario nach dem Krieg geht, werden „materielle und politische Sicherheitsgarantien für eine souveräne Ukraine“ genannt – wohlgemerkt keine militärischen.
Offene Formulierung: Hybride Bedrohungen werden zwar ebenfalls genannt, sogar im Vorwort. Sie werden aber nicht weiter ausgeführt. „Wir werden Deutschland und seine Bevölkerung gegen jede Form hybrider und konventioneller Bedrohung resilienter machen“, heißt es im Koalitionsvertrag. Dazu stärke man die Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit, des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie der zivilen Verteidigung. Wie genau, bleibt ebenfalls offen.
Europäische Abstimmung: Wie Strack-Zimmermann betont, sei es noch zu früh für eine Beurteilung der 144 Seiten – ein Koalitionsvertrag sei ohnehin immer nur eine Absichtserklärung. „Ich werde allerdings genau beobachten, was die Bundesregierung in Fragen der hybriden Angriffe und Cyberangriffe unternimmt, und wie eng sie sich mit den europäischen Staaten abspricht“, sagte sie.
Sie werde auch Merz genau beobachten. Der hatte zuletzt betont, er sei gegen eine Aufnahme der Ukraine in die Nato, solange dort Krieg herrsche. Dabei kann ein Land im Krieg grundsätzlich kein Mitglied des Verteidigungsbündnisses werden. „Er sollte also keine Selbstverständlichkeiten als Neuigkeit verkünden. Er sollte ganz deutlich zu verstehen geben, dass Deutschland der Ukraine die Sicherheitsgarantie gibt, ihren Einfluss in der Nato geltend zu machen, dass nach einem Friedensabschluss die Ukraine umgehend Mitglied der Nato wird“, fordert Strack-Zimmermann.
Die Kommunen verzeichneten im vergangenen Jahr ein Rekorddefizit in ihren Haushalten – fast 25 Milliarden Euro. Speziell in Sachen Finanzen forderten ihre Vertreterinnen und Vertreter daher eine Trendwende nach der Bundestagswahl. Worauf haben sich Union und SPD nun geeinigt? Und wie fallen die Reaktionen aus? Tim Frehler hat alle Details.
Nichts Konkretes: Im Koalitionsvertrag ist zwar von einem Zukunftspakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen die Rede, mit dem CDU, CSU und SPD die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen stärken und eine Aufgaben- und Kostenkritik vornehmen wollen. Wie das genau passieren soll, ist aber offen. Es bleibt in diesem Bereich bei Absichtserklärungen wie dieser: „Wir wollen eine Verstetigung und Verlässlichkeit der kommunalen Einnahmen.“ Konkrete Maßnahmen wie ein höherer Anteil an den Gemeinschaftssteuern sind nicht vorgesehen.
Konnexität: Ausdrücklich und per Koalitionsvertrag bekennen sich Union und SPD dazu, dass diejenige staatliche Ebene, die eine Aufgabe veranlasst, auch die Kosten dafür trägt. Der Grundsatz „wer bestellt, bezahlt“ soll gelten. Die Passage fand sich bereits im Ergebnis der zuständigen Arbeitsgruppe – und löste damals schon eher Kopfschütteln als Begeisterung bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus. Das sogenannte Konnexitätsprinzip in ein Papier zu schreiben, sei so sinnvoll wie die Aussage, man halte sich ans Grundgesetz, sagte Julia Samtleben, Bürgermeisterin in Stockelsdorf in Schleswig-Holstein.
Schneller und einfacher: Auf Wohlwollen stoßen hingegen die Pläne, die Bürokratie zu senken. Mit der geplanten Entbürokratisierung des Aufenthaltsgesetzes könne die Koalition ein erstes Ausrufezeichen setzen, sagte Städtetags-Präsident Markus Lewe. Das könne die Ausländerbehörden deutlich entlasten. Positiv sei auch, dass die Förderbürokratie verschlankt werden soll, sagte Lewe.
Digitale Verwaltung: Die Staatsreform, die derzeit in Deutschland diskutiert werde, müsse vor allem die Kommunen „als Fundament der Verwaltung, als Schnittstelle zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern nachhaltig stärken“, schrieb Laura Dornheim, Chief Digital Officer (CDO) und IT-Referentin der Stadt München, in einem Gastbeitrag in unserem Dossier Digitalwende. Ziel müsse eine digitalisierte Verwaltung sein, „die Dienstleistungen erbringt, statt Bürgerinnen und Bürger mit Formularen zu quälen“. Dafür bräuchten die Kommunen die Unterstützung des Bundes.
Altschulden: Strittig war in der AG Finanzen die Frage der kommunalen Altschulden. Die SPD schlug vor, der Bund solle sich finanziell an der Lösung des Problems beteiligen, die CSU war dagegen. Die CDU formulierte keine eigene Position – in ihren Reihen gibt es aber vor allem in Nordrhein-Westfalen großes Interesse an einer Bundesbeteiligung. Die zuständige Ministerin in Düsseldorf, Ina Scharrenbach (CDU), präsentierte im Februar einen Gesetzentwurf, mit dem das Land jährlich 250 Millionen Euro zur Entschuldung der Kommunen zur Verfügung stellt – und forderte den Bund auf, sich in gleicher Höhe zu beteiligen.
Offene Frage: Laut Koalitionsvertrag will der Bund nun tatsächlich 250 Millionen Euro pro Jahr beisteuern. Die Frage ist allerdings, wer davon profitiert. Dazu heißt es im Koalitionsvertrag nur, es gehe um jene Länder, „die ihre Kommunen durch eine landesseitige Übernahme übermäßiger Kassenkredite entlasten“. NRW hat das zwar vor, in der Vergangenheit haben das aber auch Rheinland-Pfalz, Hessen oder das Saarland getan. Das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ fordert daher, Länder, die bereits Maßnahmen für ihre finanzschwachen Kommunen ergriffen haben, dürften nicht benachteiligt werden.
Punkt für die CSU: Was die CSU für ihre Zustimmung bekommt? Die Geberländer im Länderfinanzausgleich, also allen voran Bayern, sollen pro Jahr um 400 Millionen Euro entlastet werden.
Tiefgang
Wie umgehen mit der massiv zugenommenen gesellschaftlichen Polarisierung? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in westlichen Demokratien. „Unsere Studie zeigt, dass sachliche Diskussionen dazu beitragen können, Feindseligkeiten abzubauen und Raum für einen friedlichen Dialog zu schaffen“, erläutert Egon Tripodi im Gespräch mit SZ Dossier. Der Ökonom, der an der Hertie School forscht und lehrt, hat sich in einer vom Centre for Economic Policy Research (CEPR) veröffentlichten Studie mit der gesellschaftlichen Polarisierung beschäftigt.
Tripodi hat gemeinsam mit Luca Braghieri von der Università Bocconi und Peter Schwardmann von der Carnegie Mellon University untersucht, wie faktenbasierte Gespräche dazu beitragen könnten, politische Spaltungen zu überbrücken. In den Worten von Tripodi geben die Forschungsergebnisse Hoffnung, das „gegenseitige Verständnis in einer zunehmend zerklüfteten politischen Landschaft zu fördern“.
Die Forscher haben mithilfe einer Videotelefonie-Plattform fast 1 000 Amerikanerinnen und Amerikaner zusammengebracht, um Sachfragen zu diskutieren. Die Teilnehmenden beantworteten vor und nach achtminütigen Gesprächen, die sie mit einem politischen Gleichgesinnten oder Andersdenkenden führten, Fragen zu 14 politischen Fakten. Die Plattform ermöglichte einen unstrukturierten und unmoderierten Austausch zu diesen Fragen – anschließend konnten sie diese erneut beantworten. Zudem gab es 100 Tage später eine Nachbefragung, um langfristige Auswirkungen zu untersuchen.
Gerade die vergangenen US-Wahlen hätten den Trend zu ideologischen Echokammern aufgezeigt, in denen sich Menschen mit Gleichgesinnten umgeben, sagt Tripodi. Es gebe Hinweise dafür, dass auch Freundschaften zunehmend nach politischen Präferenzen entstehen. Diese Beobachtung sei der Startpunkt für das Projekt gewesen. „Um diese Blasen zu durchbrechen, muss man den Wert unterschiedlicher Perspektiven anerkennen“, sagt Tripodi.
Und da kommen die Gespräche ins Spiel. Wie die Forscher herausgefunden haben, ziehen es Menschen vor, mit Gleichgesinnten zu sprechen, da sie erwarten, dass Gespräche mit Andersdenkenden unproduktiver und unangenehmer sind. Gleichzeitig waren die Dialoge aus Sicht der Teilnehmenden über Parteigrenzen hinweg angenehmer als gedacht und verringerten signifikant die Feindseligkeit gegenüber der Gegenseite.
So manche Annahme konnten die Forscher bestätigen. So waren Teilnehmende bereit, Geld zu zahlen, um Gespräche mit Andersdenkenden zu vermeiden, da sie diese als frustrierend und wenig hilfreich erwarteten. Wer das Gespräch dann doch geführt hat, wurde positiv überrascht: „Diejenigen, die an Gesprächen mit der Gegenseite teilnahmen, empfanden diese als genauso angenehm wie Gespräche mit Gleichgesinnten“, sagt Tripodi.
Obwohl Teilnehmende erwarteten, weniger von der Gegenseite zu lernen, lag das eigentliche Problem nicht in Fehlinformationen, sondern vielmehr in der Schwierigkeit, wertvolle Einsichten zu erkennen – und für sich zu nutzen. Die Gespräche reduzierten signifikant die Feindseligkeit gegenüber der Gegenseite und damit die Polarisierung – dieser Effekt hielt bis 100 Tage nach dem Experiment an. Das Lernen von neuen Informationen war hingegen begrenzt.
Tripodi zufolge hat die Konzentration auf sachliche Diskussionen die Polarisierung deutlich reduziert – selbst bei strittigen Themen wie der Einwanderung. „Die Teilnehmenden gewannen Einsichten und entwickelten ein besseres Verständnis für gegensätzliche Sichtweisen“, sagt er.
Eine Herausforderung: Es gab die Tendenz, dass die eigene Seite in allen Fragen besser informiert ist. Das Wissen zwischen Demokraten und Republikanern ist je nach Thema anders verteilt, aber beide Seiten sind in etwa gleich informiert. „Wenn man nicht weiß, wer Experte für was ist, wird es schwierig zu wissen, wann man ihm vertrauen kann. Das liegt vermutlich daran, dass sie nicht genug Interaktionen mit der anderen Seite haben, um zu wissen, worin sie sich auskennt“, sagt Tripodi.
Was ihm besonders auffällt: Die Forschung beobachtet derzeit ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Einsamkeit unter jungen Menschen. „Wir sehen, dass die soziale Isolation unter Menschen, die die extreme Rechte in vielen Ländern unterstützen, sehr wichtig ist“, sagt Tripodi. Dieser Gedanke, nicht zu interagieren, nicht Teil zu sein einer Gemeinschaft, könne zu einem System von Vorurteilen gegen Menschen beitragen. „Wir sehen in unserer Studie, dass die Gespräche dazu beitragen, dieses Vertrauen wiederherzustellen und Vorurteile abzubauen.“
In Deutschland gibt es ein ähnliches Format: Die Initiative „Deutschland spricht“ – ursprünglich von Zeit Online ins Leben gerufen – bringt Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten zusammen, die sich zu einem Thema unterhalten. „Wir können aus diesen Erkenntnissen lernen, dass wir Dinge tun können, die viel leichter und kostengünstiger sind, etwa die Gestaltung einer Online-Plattform“, sagt Tripodi. „Es ist also eine gute Nachricht, dass wir Dinge wie ‚Deutschland spricht‘ auf eine Art und Weise skalieren können, die durch moderne Technologien möglich ist.“
Ob die Ergebnisse seiner Studie auch für Deutschland wertvoll sein können? Ja, sagt Tripodi. Denn auch hierzulande gebe es ähnliche Strukturen. „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die europäische Politik oft komplexer ist: Wir haben kein Zweiparteiensystem wie in den USA“, sagt er. Es gebe aber einen Wettbewerb zwischen der extremen Rechten und den Parteien der Mitte. Und auch soziologische Ähnlichkeiten zu den USA, was die politischen Präferenzen angeht: etwa ein Stadt-Land-Gefälle. „Ich denke daher, dass die Studie in diesem Sinne nützlich ist“, sagt Tripodi.
Fast übersehen
Neues zur Brandmauer: CDU-Politiker Jens Spahn hat empfohlen, bei organisatorischen Fragen im Parlament einen Umgang mit der AfD zu pflegen wie mit anderen Oppositionsparteien. Er sprach etwa von Abläufen im Parlament oder Verfahren in der Geschäftsordnung. „Da würde ich einfach uns empfehlen, mit der AfD als Oppositionspartei so umzugehen in den Verfahren und Abläufen, wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch“, sagte er Bild.
Die Kritik folgte prompt. „Wäre die AfD eine Oppositionspartei wie jede andere, käme Herr Spahn gar nicht auf die Idee, so was zu sagen“, sagte Grünen-Chefin Franziska Brantner der SZ. Das sei sie aber nicht, sondern „eine destruktive, zum Teil gesichert rechtsextreme Organisation, die unsere demokratischen Freiheiten untergraben möchte“. Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek sagte der SZ, „Menschen wie Jens Spahn, die noch immer nicht begriffen haben, dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist, die die Menschenrechte mit Füßen tritt und die Demokratie zerstören will, sind Teil des Problems“.
Neues zum Nationalen Sicherheitsrat: Der Sicherheitsexperte und Terrorismusforscher Peter Neumann hat ein Konzept vorgelegt, wie ein Nationaler Sicherheitsrat aussehen könnte. Über das Papier hat ThePioneer zuerst berichtet. Wie das Portal erfuhr, hat das CDU-Mitglied Interesse daran, den Sicherheitsrat zu leiten. Wie Neumann ausführt, soll sich das Gremium alle vier Wochen treffen und kurzfristig bei Bedrohungslagen zusammenkommen.
Den Vorsitz soll der Bundeskanzler übernehmen. Ständige Mitglieder wären die Ministerinnen und Minister der Ressorts Innen, Verteidigung, Außen, Finanzen und Wirtschaft, dazu neben dem Chef des Bundeskanzleramts die Präsidentinnen und Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Verfassungsschutzes, Bundeskriminalamts, der Bundespolizei, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik sowie der Generalinspekteur der Bundeswehr. Je nach Thema und Bedarf sollen laut Neumann weitere Ministerinnen oder Ministerpräsidenten dazukommen kommen.
An Vorbildern orientieren: Ein Nationaler Sicherheitsberater soll die Sitzungen des Sicherheitsrats vorbereiten und koordinieren. Zudem soll er ein Referat „Strategische Vorausschau“ leiten. Seine Position soll laut Neumann die eines „unabhängigen Beraters“ der Bundesregierung beziehungsweise des Bundeskanzlers für sicherheitspolitische Themen sein. Falls Deutschland einen Sicherheitsrat einführt, schreibt Neumann, sollte man das Beste aus bestehenden Systemen übernehmen – er nennt vor allem Großbritannien, die USA und Frankreich – und an den Föderalismus und die Koalitionsdynamiken anpassen.
Neues zum Datenschutz: Die Bundesdatenschutzbeauftragte Louisa Specht-Riemenschneider (BfDI) blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf den neuen Koalitionsvertrag. Dass sie künftig zentral für die Aufsicht über die Wirtschaft zuständig sein soll, was bisher die Landesdatenschutzbeauftragten innehaben, begrüßte sie bei der Vorstellung ihres ersten Tätigkeitsberichts in der Bundespressekonferenz in Berlin. „Ich bin bereit, diese neue Verantwortung anzunehmen“, sagte sie. Gleichzeitig zeigte sie sich besorgt über die geplante Ausweitung von Überwachungsbefugnissen.
Zentralisierung vs. Bündelung: Specht-Riemenschneider sah auf Nachfrage unseres Dossiers Digitalwende keinen Unterschied zwischen einer „Zentralisierung“ (Wortlaut in den Sondierungspapieren) und einer „Bündelung“ (Wortlaut im Koalitionsvertrag) der Aufsicht über die Wirtschaft. Im Gesetz könnten etwa Branchen festgeschrieben werden, für die die BfDI zentral zuständig ist, sagte Specht-Riemenschneider. Derzeit wird die Zuständigkeit für die Aufsicht über den Sitz des jeweiligen Unternehmens geregelt.
Freiheit vs. Sicherheit: „Das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit ist sensibel und wir müssen gucken, wohin wir Schritt für Schritt gehen“, sagte Specht-Riemenschneider auf die Frage von SZ Dossier. Das mache ihr datenschutzrechtlich am meisten Sorge am neuen Koalitionsvertrag. Die Speicherung von IP-Adressen erwähnte sie auch in ihrem Tätigkeitsbericht kritisch. „Aufgabe dieser Regierung ist es, dieses Verhältnis nicht zu kippen.“
Unter eins
Maria Noichl, Vorsitzende der AG Frauen, fordert im Tagesspiegel, Esken soll ihren Posten behalten dürfen oder einen neuen bekommen
Zu guter Letzt
Sie macht doch weiter: Sahra Wagenknecht will Parteichefin des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bleiben. „Ich habe anderthalb Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert“, sagte sie dem Spiegel. Da werde sie nicht zuschauen, dass es jetzt „wegen 9500 angeblich fehlender Stimmen“ den Bach heruntergehe. Aus der rein operativen Arbeit wolle sie sich aber künftig heraushalten. „Die reine Organisation müssen andere machen“, sagte sie.
Vor der Bundestagswahl hatte sie noch gesagt, die Wahl sei auch die Entscheidung über ihre politische Zukunft. Wagenknecht nannte das vergangene Jahr „die Hölle“. Ihr Leben, erzählte sie, habe zuletzt aus einer „ununterbrochenen Stressmühle“ bestanden. Daneben sei für nichts anderes mehr Zeit gewesen. Sie habe etwa kein einziges Buch zu Ende gelesen und es nur noch mit Mühe geschafft, wenigstens in der Tagespolitik auf dem Laufenden zu bleiben.
Ihr Fazit: Sie habe den Einsatz unterschätzt, „den eine neue Partei erfordert, in der noch kein Apparat vorhanden ist, in der im Grunde zunächst alles fehlt, was man braucht“. Bald soll sich das BSW öffnen: „Wir können die Leute ja nicht ewig warten lassen und sollten froh sein, dass immer noch so viele bei uns Parteimitglied werden wollen“, sagte Wagenknecht. Jetzt stehe aber erst einmal ein Urlaub mit ihrem Mann an, in der Provence.