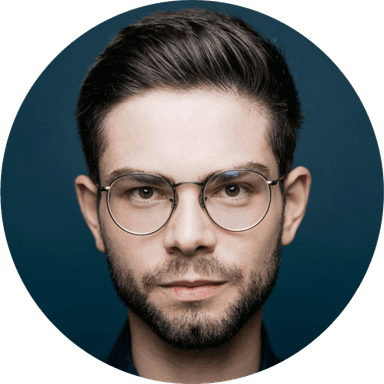Unsere Kernprodukte
Im Fokus
Weitere SZ-Produkte
Shops und Marktplätze
Media & Service
Partnerangebote
Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserierenMöchten Sie unsere Texte nachdrucken, vervielfältigen oder öffentlich zugänglich machen?
Nutzungsrechte erwerben
Was hat die neue Regierung gegen Rechtsextremismus vor?
Donnerstag, 17. April 2025Schnelldurchlauf:
Union und Auswärtiges Amt streiten über Afghanistan-Aufnahmeprogramm +++ Wie Spahns AfD-Vorstoß die Gemüter erhitzt +++ Mindestlohn-Vorschlag soll im Juni kommen +++ Digitalministerium: Brinkhaus fordert Tempo und Kreativität +++ Tiefgang: (K)eine Strategie gegen Rechtsextremismus?
Guten Morgen. Ein Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen ist gestern auf dem Flughafen Leipzig-Halle gelandet. An diesen Flügen, die Menschen von Pakistan aus nach Deutschland bringen, hat sich mittlerweile ein politischer Streit entzündet. Noch spielt der sich vor allem zwischen dem Auswärtigen Amt und der Union ab.
In wenigen Wochen aber wird eine Politikerin oder ein Politiker der CDU das Außenministerium übernehmen. Und damit aller Voraussicht nach die Frage, wie mit den Menschen umgegangen werden soll, die weiter auf eine Ausreise nach Deutschland warten.
Auf die Details dazu blicken wir gleich. Vorher noch ein kleiner organisatorischer Hinweis: Nach einer kurzen Osterpause finden Sie unser Dossier am Dienstagmorgen um 6:30 Uhr wieder in Ihrem Postfach.
Willkommen am Platz der Republik.
Was wichtig wird
Unter den Menschen, die in Pakistan auf eine Ausreise nach Deutschland warten, befinden sich einerseits Ortskräfte. Es geht aber auch um Afghanen, die in ihrem Land Verfolgung durch die islamistischen Taliban fürchten müssen. Doch die Ansichten darüber, wie groß die Gefährdungslage in Afghanistan ist, gehen auseinander. „Eine besondere Verfolgung bestimmter Gruppen ist in Afghanistan nicht nachzuweisen“, sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hardt SZ Dossier. Für das Bundesaufnahmeprogramm gebe es daher keine Grundlage. Die Taliban seien „hochproblematisch, aber im internationalen Vergleich gibt es zig andere Länder mit schlechterer Menschenrechtslage“.
Im Außenministerium sieht man das anders. Ein Sprecher teilte SZ Dossier mit, die Menschenrechtssituation in Afghanistan habe sich „seit der Machtübernahme des De-facto-Regimes“ deutlich verschlechtert – und gehe „immer weiter bergab“. „Die systematische Diskriminierung und Unterdrückung hat Afghanistan zu einem der weltweit gefährlichsten Orte für Frauen und Mädchen werden lassen“, heißt es aus dem Außenministerium. Kritikerinnen und Kritiker der Taliban seien starker Repression ausgesetzt.
Wer gekommen ist: Die Bundesregierung habe in den vergangenen Jahren über verschiedene Aufnahmeverfahren bereits mehr als 36 000 besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen die Einreise nach Deutschland ermöglicht. Darunter sind knapp 21 000 ehemalige Ortskräfte und ihre Familienangehörigen, aber laut Angaben des Außenamts mehr als 1400 Menschen, die über das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan (BPA) eingereist sind. Die weiteren 14 000 Personen sind über zwei weitere Programme eingereist.
Wer noch kommen soll: Nach Angaben des Außenministeriums befinden sich in Pakistan noch etwa 2600 Personen mit einer Aufnahmezusage in einem der drei Aufnahmeverfahren. Eine Aufnahmezusage bedeutet allerdings noch nicht, dass die Person auch wirklich einreisen darf. Dafür braucht es noch ein Visum. Außerdem muss die Person eine Sicherheitsüberprüfung bestehen. Beides findet in Pakistan statt. Falls eine Aufnahme erklärt wird, umfasst sie die Hauptperson und etwaige Begleitpersonen.
Was die CDU plant: Laut CDU-Außenpolitiker Hardt solle Deutschland der Verantwortung für Afghanistan durch eine „transparente und auf Fortschritte bedachte Afghanistanpolitik“ nachkommen, nicht durch „ein undurchsichtiges, korruptionsanfälliges Aufnahmeprogramm für einige wenige“. Er kündigte an, die neue Bundesregierung werde die Zusagen genau auf ihren Rechtscharakter prüfen. „In jedem Fall stehen diese Zusagen unter dem Vorbehalt der Visumserteilung, auf die es regelmäßig keinen Anspruch gibt“, sagte Hardt.
Wer genau sitzt in den Fliegern? Das Auswärtige Amt teilte SZ Dossier mit, die Mehrheit der Personen auf den letzten Flügen seien Frauen und Minderjährige gewesen. Auf dem Flug vom 27. März seien insgesamt mehr als 80 Frauen und Mädchen gewesen, hieß es. Für weitere Flüge aus der jüngeren Vergangenheit nannte das Außenamt ähnliche Zahlen: Am 24. Februar etwa hätten sich ebenfalls 80 Frauen und Mädchen an Bord befunden – und über 60 Minderjährige, darunter mehr als 40 Kinder unter zehn Jahren.
CDU-Politiker Jens Spahn hat jüngst eine neue Debatte zum Umgang mit der AfD ausgelöst. Seine Forderung: Man solle die AfD bei parlamentarischen Verfahren und Abläufen so behandeln wie jede andere Oppositionspartei. Es geht Spahn nicht um eine inhaltliche Zusammenarbeit, sondern etwa darum, AfD-Ausschussvorsitzende zu wählen. Sein Vorstoß sorgt allerdings für immer mehr Ärger, vor allem der angehende Koalitionspartner ist entsetzt. „Ausschussvorsitze und Vizepräsidentenposten sind keine Automatismen“, sagte SPD-PGF Katja Mast der SZ.
Keine Mehrheiten: Zahlreiche Kandidaten der AfD hatten in den vergangenen Jahren die jeweils nötigen Mehrheiten verfehlt. „So funktioniert Demokratie. Die AfD-Kandidatinnen und -Kandidaten scheitern an fehlenden Mehrheiten“, sagte Mast. Sie betonte jedoch auch: „Die AfD ist keine normale Partei wie jede andere. Sie versucht, unsere Institutionen zu zersetzen.“ Im schwarz-roten Koalitionsvertrag war sogar eine Anti-AfD-Klausel eingefügt worden, worauf sie sich in der SPD nun berufen (mehr dazu hier). Die Sozialdemokraten sehen nun eine zusätzliche Belastung für das laufende Mitgliedervotum.
Gespaltene Partei: In der CDU gibt es Befürworter der Spahn-Initiative wie etwa Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer oder Fraktionsvize Johann Wadephul. Aber auch Kritiker wie den Abgeordneten Roderich Kiesewetter. Wie Daniel Brössler, Georg Ismar und Roland Preuß in der SZ berichten, äußerte sich Spahn bei einer Begegnung mit der Hauptstadtpresse öffentlich nur zur Wirtschaftspolitik. Intern soll er sich damit gerechtfertigt haben, keine neue Linie, sondern nur den Ist-Zustand beschrieben zu haben.
Herzliche Einladung: Spahn hatte betont, man müsse im Kopf haben, dass die AfD so stark sei, „weil Wählerinnen und Wähler uns was sagen wollten“. Deswegen gehe es darum, die „richtige Balance“ zu finden. In der AfD sieht man Spahns Äußerungen als Bestätigung. „Wir freuen uns, wenn Herr Spahn seine Partei dazu aufruft, parlamentarische und demokratische Grundregeln zukünftig zu respektieren“, sagte AfD-Chef Tino Chrupalla der SZ. Er lade Spahn und seine Kollegen zu persönlichen Gesprächen ein, „um sich einen Eindruck zu verschaffen“.
Streit um Saal: Derweil geht der Zwist um den zweitgrößten Fraktionssaal im Bundestag weiter, in den die AfD als zweitgrößte Fraktion gerne einziehen würde. Die SPD will ihren Otto-Wels-Saal jedoch nicht abgeben. Wie die Bundestagsverwaltung SZ Dossier bestätigte, erfolgt die Verteilung der Räume in Verhandlungen zwischen den Fraktionen. Wird keine Einigung erzielt, entscheidet der Ältestenrat. Hierzu steht ein Sitzungstermin noch aus. Eine abschließende Entscheidung ist der Verwaltung nicht bekannt. Die AfD erwägt nun eine Klage, nachdem sich in einer Runde der Fraktionsgeschäftsführer in dieser Frage eine Mehrheit gegen sie angedeutet hatte.
Nachdem es zwischen den künftigen Koalitionspartnern Union und SPD einen Dissens bei der Auslegung des Koalitionsvertrags beim Thema Mindestlohn gegeben hatte, hatte sich die Mindestlohnkommission kürzlich zu Wort gemeldet und ihre Unabhängigkeit betont. Die Vorsitzende des Gremiums, Christiane Schönefeld, teilte mit, die Mitglieder unterlägen bei der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit keinen Weisungen. Es gilt als ungewöhnlich, dass sich das Gremium in dieser Form an die Öffentlichkeit wendet.
Wie denn nun? Nachdem die SPD in ihrer Kommunikation an Wähler und Mitglieder formuliert hatte, dass der Mindestlohn auf 15 Euro angehoben wird, sagte der designierte Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz in einem Interview mit der Bild am Sonntag, dass es „keinen gesetzlichen Automatismus“ geben werde. Man habe lediglich vereinbart, dass die Mindestlohnkommission „in diese Richtung denkt“. Seit dem Wochenende geht die Debatte darüber weiter, welche Lesart stimmt.
Wer denn nun? Der Gesetzgeber hat nach Einführung des Mindestlohns 2015 die Mindestlohnkommission eingerichtet, die nötige Anpassungen unabhängig von politischem Einfluss errechnen soll. Das Gremium besteht aus einem oder einer Vorsitzenden und sechs stimmberechtigten Mitgliedern. Drei von ihnen sind Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerseite, drei vertreten die Arbeitgeberseite. Hinzu kommen zwei beratende Mitglieder aus der Wissenschaft ohne Stimmrecht. Die Kommission stimmt darüber ab, welcher Vorschlag der Bundesregierung zur Höhe des Mindestlohns gemacht werden soll.
Wann denn nun? Die Mindestlohnkommission hat bereits angekündigt, Ende Juni ihre Empfehlung abzugeben. Seit Beginn des Jahres liegt der Mindestlohn bei 12,82 pro Stunde. In der Regel schlägt die Mindestlohnkommission alle zwei Jahre eine Erhöhung vor. Da diese stufenweise kommt, steigt die tatsächliche Höhe des Mindestlohns fast jährlich. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass es bis zum 1. Januar 2016 – wie im Koalitionsvertrag formuliert – eine Anpassung geben kann. Sicher ist aber nicht, dass diese, wie von der SPD gewünscht, auch tatsächlich bei „60 Prozent des mittleren Einkommens“ liegen wird.
Beim Aufbau des neuen Bundesministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung gebe es „keine Zeit mehr zu verlieren“, forderte der CDU-Abgeordnete Ralph Brinkhaus, der in der AG Staatsmodernisierung den Koalitionsvertrag mitverhandelt hat, im Interview mit Matthias Punz in unserem Dossier Digitalwende. „Der erste Schritt ist gemacht, jetzt müssen schnell der zweite, dritte und vierte folgen.“
Andere Wege gehen: „Wir müssen schnell Ziele formulieren und daraus erste Projekte ableiten“, sagte Brinkhaus. „Wir können unabhängig von der Organisationsstruktur des Hauses Projektteams bilden, die sofort zu arbeiten beginnen.“ Das Ministerium solle dann parallel aufgebaut werden. Die benötigte Zentralabteilung, die sich in jedem Ministerium um die innere Verwaltung kümmert, könne von einem anderen Ressort mitgenutzt werden, schlägt Brinkhaus vor. „Völlig überschätzt“ sei zudem die Frage nach einem Gebäude: „Wenn das Digitalministerium nicht in der Lage ist, remote zu arbeiten, wer soll es denn dann hinbekommen?“
Chefsache: In der Verantwortung sieht Brinkhaus vor allem den künftigen Kanzler Friedrich Merz (CDU). Er und sein Vize Lars Klingbeil (SPD) müssten „zu hundert Prozent dahinterstehen“ und ihren Ministerinnen und Ministern die Ansage machen, „dass es bei der Staatsmodernisierung keine Ressortegoismen geben darf“, sagte Brinkhaus. Alle müssten wissen: „Dein Ziel ist, den Staat zu modernisieren und zu digitalisieren – und dem ordnest du dich unter.“
Große Unklarheit: Die Fragen nach einer Digitalagentur, einem zentralen Digitalbudget, der Steuerung des nachgelagerten Bereichs oder eines Vetorechts des neuen Hauses blieben im Koalitionsvertrag unbeantwortet. Hier müsse „noch viel ausformuliert werden“, sagte Brinkhaus. Dass das wohl der kommenden Spitze des Hauses überlassen werden soll, mache die Situation schwieriger. Generell müsse die Person aufpassen, „nicht zur Königin oder zum König ohne Reich“ zu werden, sagte Brinkhaus. Ein neues Haus brauche Hebel, um etwas zu bewegen: „Für die Digitalisierung ist ein zentrales Digitalbudget so ein Werkzeug, für die Staatsmodernisierung könnte es die Zuständigkeit für das gemeinsame Personalmanagement sein.“
Tiefgang
Ein kurzer Überblick über die Nachrichten der vergangenen Tage: Vier Neuntklässler aus Görlitz zeigten im März in Auschwitz-Birkenau eine rechtsextreme Geste. Ein Foto davon landete in den sozialen Medien.
In Oelsnitz im Erzgebirge ließ sich eine Lehrerin vorzeitig versetzen, nachdem ihr im Januar drei Vermummte auf einem Parkplatz aufgelauert, sie mit einer Taschenlampe geblendet und die Reichskriegsflagge gezeigt hatten. Zeit Online sagte die Lehrerin, die Vermummten hätten „Sieg Heil“ und „Wir schicken dich ins KZ“ gerufen.
Die Oberbürgermeisterin von Zwickau, Constance Arndt, erhielt eine Morddrohung per Mail. Der Verfasser nannte sich „Adolf Hitler“ und wählte „nsu@gmail.com“ als Absenderadresse.
Bereits im Februar offenbarte die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Petra Pau (Die Linke) einen bundesweit neuen Höchststand rechtsextremer Straftaten im Jahr 2024.
Die künftige Bundesregierung übernimmt also ein Land, in dem die Hemmschwelle offenbar gesunken ist, in dem der Rechtsextremismus auf dem Vormarsch ist. Wie aber wollen Union und SPD diesem Problem begegnen?
Im Koalitionsvertrag blieben die Verhandlerinnen und Verhandler vage. Dort finden sich zwar Sätze wie dieser: „Wir bekämpfen die Ausbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts und rechtsextremistischer Strukturen in unserer Gesellschaft systematisch und mit aller Entschlossenheit.“ Wie CDU, CSU und SPD das umsetzen wollen, sagen sie allerdings nicht.
Konkret wird es nur an wenigen Stellen. Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ will die Koalition in spe zum Beispiel fortsetzen, es aber „in Bezug auf Zielerreichung und Wirkung“ überprüfen. Auch die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle soll weitergehen. Den nationalen Aktionsplan gegen Rassismus will Schwarz-Rot „aufbauend auf einer wissenschaftsbasierten Rassismus-Definition neu auflegen, um Rassismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen zu bekämpfen“.
Um unter anderem den Schutz von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern zu verbessern, soll das Melderecht überarbeitet werden. Für Kommunalpolitiker soll ein erweiterter Schutz im Strafrecht geprüft werden. Geeinigt haben sich CDU, CSU und SPD auf ein NSU-Dokumentationszentrum in Nürnberg. Das war in der Arbeitsgruppe Innen, Recht, Migration und Integration noch strittig.
Geregelt werden soll zudem der Entzug des passiven Wahlrechts bei mehrfacher Volksverhetzung, der Tatbestand Volksverhetzung selbst soll verschärft werden. Außerdem wollen Union und SPD prüfen, inwiefern man eine Strafbarkeit für den Fall einführen kann, dass Amtsträger und Soldaten im Zusammenhang mit ihrer Dienstausübung in geschlossenen Chatgruppen antisemitische oder extremistische Hetze teilen.
Kritikerinnen und Kritikern geht das alles nicht weit genug. Die Geschäftsführerin des Bundesverbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, Heike Kleffner, sagte der taz kürzlich, es gebe im Koalitionsvertrag keine politische Strategie zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, keinen Nationalen Aktionsplan und keine Bund-Länder-Task-Force.
Clara Bünger, Bundestagsabgeordnete der Linken, sagte SZ Dossier: „Was SPD und Union in Sachen Rechtsextremismus-Bekämpfung in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten haben, ist angesichts der zunehmenden Gewalt von rechts besorgniserregend – vor allem im Bereich der Präventionsarbeit.“
Bünger befürchtet, die Lage könnte sich sogar noch verschlechtern. Je nach Ausgang der Überprüfung des Programms „Demokratie leben!“ könnten zivilgesellschaftlichen Projekten, mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus oder Opferberatungsstellen nämlich Ressourcen entzogen werden. „Von einem Demokratiefördergesetz, das dringend benötigt würde, um Demokratieprojekte verlässlich und langfristig zu finanzieren, ist in den Vereinbarungen von Union und SPD überhaupt keine Rede“, sagte Bünger.
So entsteht der Eindruck, die künftige Koalition dreht allenfalls an ein paar kleinen Schräubchen, wirklich neue Ideen im Kampf gegen Rechtsextremismus hat sie kaum. Problematisch ist das auch vor dem Hintergrund, dass die Akteure im rechtsextremen Spektrum sehr wohl neue Ideen haben.
Aufgefallen sind Verfassungsschützern etwa die Demonstrationen gegen CSD-Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Zu solchen Aktionen sei innerhalb der Neonaziszene eine starke Mobilisierung zu beobachten gewesen, heißt es etwa im Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen. Bemerkenswert sei das, weil die Neonaziszene in den vergangenen Jahren eigentlich an einer deutlichen Mobilisierungsschwäche gelitten habe. Nun würden aber vor allem Jugendliche und junge Erwachsene im virtuellen Raum rekrutiert.
Das beobachteten auch die Kollegen in Sachsen: Sowohl parteigebundene als auch parteiungebundene Gruppen hätten „vom verstärkten Zulauf junger Menschen profitiert, den die rechtsextremistische Szene seit 2024 erfahren hat“, teilt das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen auf Anfrage mit. Der Zulauf sei vor allem mit den Protesten gegen CSD-Veranstaltungen verknüpft gewesen.
Es sei zwar fraglich, ob das Thema Queerfeindlichkeit die jungen Akteure dauerhaft mobilisiere, schreiben die Verfassungsschützer aus NRW. Denkbar sei aber, dass die Gruppen einfach andere Themenfelder besetzen. In jedem Fall sei festzustellen, dass sich die Neonaziszene entgegen dem Trend verjünge. Das aggressive Auftreten bei den CSD-Veranstaltungen sowie der gewaltbefürwortende Diskurs in Social-Media-Gruppen deuteten darauf hin, „dass mit dieser Verjüngung auch das Gewaltpotenzial der Szene nochmal zunimmt“. Der Handlungsdruck nimmt also nicht ab. Tim Frehler
Fast übersehen
Elektronische Patientenakte: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat den bundesweiten Start der elektronischen Patientenakte (ePA) für den 29. April angekündigt. Ab Oktober soll sie dann für Arztpraxen und Kliniken verpflichtend sein. „Die elektronische Patientenakte macht die Behandlung besser, Medikationsfehler werden vermieden. Daran sterben in Deutschland täglich Menschen“, sagte Lauterbach gestern in Berlin. Es sei allerhöchste Zeit, sagte der SPD-Minister, die Einführung hätte niemals 20 Jahre dauern dürfen.
Worum geht es? In der ePA sollen etwa Arztbriefe, Befunde, Laborwerte und Medikamentenpläne gesammelt werden. In der Einführungsphase soll die Nutzung der ePA kontinuierlich steigen, Patientinnen und Patienten können der Nutzung aber widersprechen.
Die Frage nach der Sicherheit: Die medizinische Versorgung habe sich nach Ansicht des Ministers in den bisherigen Modellregionen durch die ePA spürbar verbessert. Sicherheit stehe dabei „an vorderster Stelle“, betonte Lauterbach in einem Brief an die Gesellschafter der Digitalagentur Gematik. Gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) seien entsprechende Maßnahmen umgesetzt worden. Digitalexpertin Bianca Kastl, die im Dezember auf die Sicherheitsmängel hingewiesen hatte, betonte gestern hingegen, diese seien noch nicht behoben.
Sorge vor Rollback: Der noch amtierende Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), hat im Interview mit dem Deutschlandfunk kritisiert, dass der Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot zu wenig Politik für die queere Community vorsieht. Er finde es sehr enttäuschend, dass Themen wie die Gleichstellung lesbischer Mütter beim Abstammungs- und Familienrecht oder ein besserer verfassungsrechtlicher Schutz von queeren Menschen im Vertrag gar nicht auftauchen. „Ich glaube, wir müssen uns das auf einige Jahre bestenfalls Stillstand, vielleicht sogar Rückschritte einstellen“, sagte Lehmann.
Bleibt ein Queer-Beauftragter? Das Selbstbestimmungsgesetz soll zwar in der neuen Legislaturperiode evaluiert werden. Der Grüne kündigte deshalb an, dass seine Fraktion genau darauf achten werde, dass es dabei zu keiner Verschlechterung komme. Er sei aber froh, dass sich die Union nicht mit ihrer Forderung durchsetzen konnte, das Gesetz ganz abzuschaffen, so Lehmann. Ob es das Amt des Queer-Beauftragten in der kommenden Regierung erneut geben wird, ist bislang unklar. Die Ampel hatte den Posten im Range eines Staatssekretärs erstmals geschaffen.
Fulbright auf der Kippe: Die Trump-Administration erwägt laut Medienberichten weitgehende Kürzungen in ihrer Außenpolitik, die das Ende zahlreicher Programme wie des Fulbright-Programms bedeuten würden. SZ Dossier hatte über die vorübergehende Aussetzung der Finanzierung berichtet, die Auswirkungen auf den Alltag zahlreicher Stipendiatinnen und Stipendiaten hatte. Auch ein Ende des Programms für den akademischen Austausch wurde befürchtet – nun berichten Washington Post und New York Times über ebensolche Überlegungen.
Drastische Sparpläne: Demnach könnten fast 50 Prozent des Geldes im Außenministerium wegfallen, darunter nahezu alle Mittel für internationale Organisationen wie UN und Nato. Laut der Post würden alle „vom Außenministerium verwalteten Bildungs- und Kulturprogramme, einschließlich des Fulbright-Programms“ eingestellt werden. Auch zwei US-Konsulate in Deutschland könnten von den Sparplänen betroffen sein. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums betonte, die Pläne seien nicht abschließend abgestimmt.
Unter eins
Bundeskanzler in spe Friedrich Merz im Gespräch mit den Funke-Zeitungen über die Liste für sein künftiges Kabinett
Zu guter Letzt
Julia Klöckner führt in einem Video durch den Andachtsraum des Bundestages, zeigt die sieben Holztafeln, die an der Wand lehnen. Die Kunstwerke schmücken den Raum, der Abgeordneten und Beschäftigten des Bundestags als Ort der Besinnung dienen soll. Der Social-Media-Auftritt der neuen Bundestagspräsidentin unterscheidet sich schon früh vom öffentlichen Auftritt ihrer Vorgängerin Bärbel Bas. Klöckner dokumentiert in kurzen Clips, wie es im Bundestag aussieht: etwa ihr Büro mit Blick auf die Baustelle am Platz der Republik, eine Ausstellung im Paul-Löbe-Haus und eben der Andachtsraum.
Auf Anfrage von SZ Dossier erklärte Klöckner, jede Person habe ihren eigenen Stil im Umgang mit den digitalen Medien – da wolle sie keine Vergleiche ziehen. „Aber wir müssen als Politiker auch da hin, wo unsere Gesellschaft sich aufhält, diskutiert, sich Meinungen bilden“, sagte die Bundestagspräsidentin. Also: Tiktok, Facebook, X – denn unter anderem dort hat sie das Video gepostet. Parlamentarische Abläufe und Verfahren seien oft von außen betrachtet kompliziert, müssten immer wieder erklärt werden: „Darauf haben die Bürger auch einen Anspruch“, sagte sie. Deshalb ermögliche sie Einblicke in das Hohe Haus und in ihre Arbeit.
Aus ganz Deutschland folgten ihrem eigenen und dem Bundestagsaccount Tausende Menschen, um Politik zu verstehen: „Das einzige direkt gewählte Verfassungsorgan sollte deshalb auch an den digitalen Theken präsent sein – in Ton und Stil der Würde des Hauses und des Amtes natürlich angemessen“, sagte Klöckner. Parlamentarische Einblicke im Hochformat gibt es künftig also auch direkt aus der Präsidialebene – und nicht mehr nur auf den offiziellen Kanälen des Bundestages.